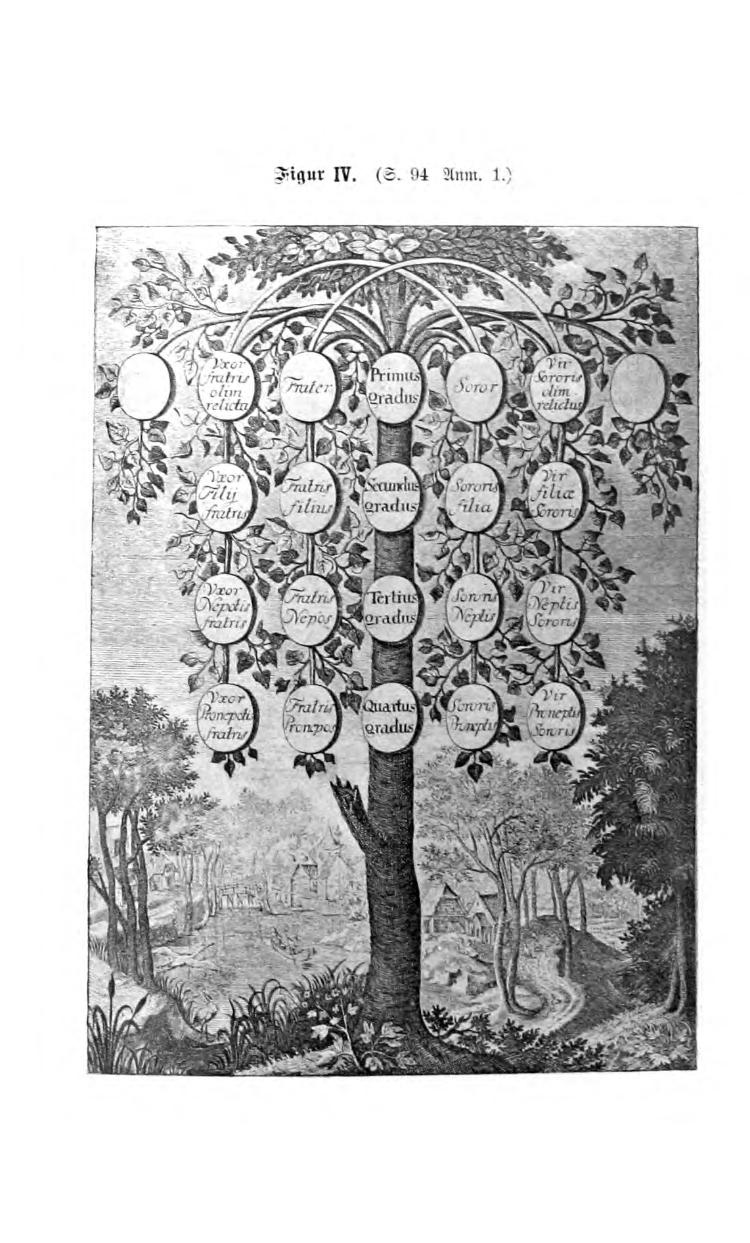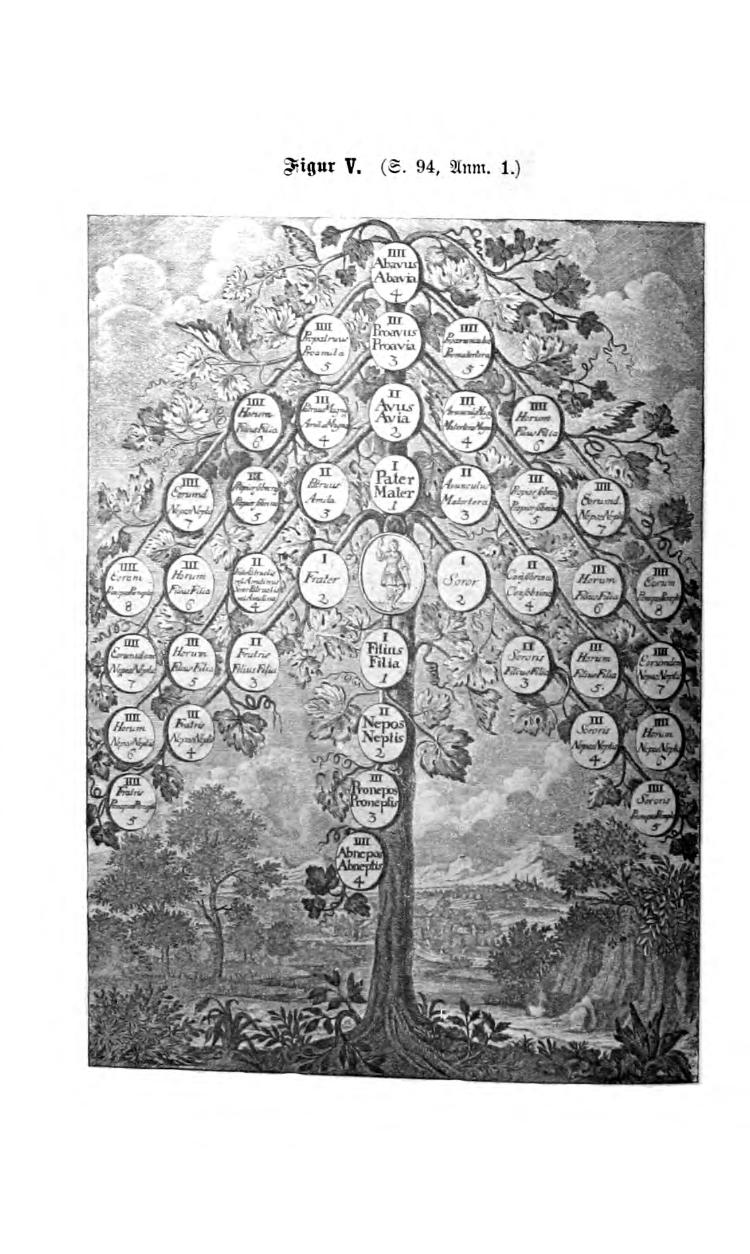| |
|
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Benutzer:Arend/Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie/E-Book
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
|
(Titel ≡)
Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschichtlichen, sociologischen und naturwissenschaftlichen Bedeutung
Professor der Geschichte.
Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung). 1898. (III ≡)
Vorwort.
Indem ich den Versuch gemacht habe, die Genealogie als Wissenschaft in ihren gesammten Beziehungen zu historischen, gesellschaftlichen, staatlichen, rechtlichen und vor allem auch naturwissenschaftlichen Fragen und Aufgaben systematisch darzustellen, muß ich es dem Leser des Buches selbst überlassen, sich ein Urtheil über den bemerkten Mangel jetziger und über die zu erwartenden Aussichten und Vortheile künftiger Studien in dieser Richtung zu bilden. Wenn man indessen nach den Ursachen forschen wollte, welche den Fortschritt des genealogischen Studiums hauptsächlich (IV ≡)
verhinderten, so dürfte man nicht leugnen, daß dieselben auch zum großen Theile in der Art und Weise der Behandlung dieser Disziplin zu suchen waren. Sie ist zweimal im Laufe ihrer litterarischen Entwicklung auf Abwege gerathen, durch die sie Dienerin thörichter Vorurtheile geworden ist. Die genealogische Gelehrsamkeit hat zuweilen dem Schwindel politischer und persönlicher Eitelkeit nachgegeben und ist zum andernmal zu einem Spielzeug unkritischer Liebhabereien herabgesunken. Manche haben behauptet, daß selbst bedeutende Familien durch falsche genealogischen Lehren zu politischen Irrthümern verleitet worden seien, und andere haben auf die Gefahren aufmerksam gemacht, welche dem Ernst der Wissenschaft durch den Dilettantismus eines der Geschichte verwandten Studiums drohen könnten. Indessen sind Abwege auch bei der Geschichte anderer großer Disciplinen, wie etwa Astronomie und Chemie, wahrzunehmen gewesen. Wird es heute jemand einfallen, die Berechnung der Nativitäten, oder die Goldmacherkunst, die selbst von den größten Gelehrten betrieben wurden, zu einem Vorwurf gegen diese Wissenschaften selbst auszubeuten? Wenn sich aber in angesehenen biographischen Werken etwa von einem Manne, wie Philipp Spener, eine in jeder anderen Beziehung zu rühmende Darstellung findet, in der jedoch nur seiner genealogischen Verdienste eben mit keinem Worte gedacht ist, so muß man vermuten, daß dieser Wissenschaft in einem großen Kreise der gelehrten Welt die ihr gebührende Würdigung nicht mehr zu Theil wird. Und dennoch ist man in mannigfachen Zweigen psychologischer und naturwissenschaftlicher, sowie soziologischer Disziplinen heute ohne Zuthun des historischen Betriebs mehr und mehr in einer genealogischen Richtung thätig. Von Vertretern eben dieser (V ≡)
Wissenschaften sind Wünsche ausgesprochen worden, mehr historisches Material zu besitzen, um die Aufgaben lösen zu können, die sich von ihrem Standpunkte erheben. Ich leugne nicht, daß zunächst meine Hoffnungen eben auf diese Kreise am meisten gerichtet sind, wenn ich erwarte, daß den genealogischen Studien ein neues Zeitalter sich eröffnen werde und müsse. Bis dahin kann man indessen jenen Bestrebungen nicht genug Dank und Aufmerksamkeit zuwenden, welche in selbstgewählter Thätigkeit und durch private Veranstaltungen sich bemühen, dem genealogischen Studium Arbeiter und Freunde zu erwerben, wie die beiden Vereine „Adler“ in Wien und „Herold“ in Berlin, welchem letzteren ich dieses Werk seit Jahren zugedacht habe und hiermit auch zueigne. Möchte das gute Beispiel, welches in diesem Augenblicke in Berlin durch die von der Adelsgenossenschaft veranstalteten Vorlesungen über Genealogie gegeben worden ist, recht befruchtend wirken! In nicht allzuferner Zeit werden sich ja doch Regierungen, die für die Interessen der Wissenschaft thätig sind, entschließen müssen, das dicke Scheuleder der Fakultäten zu durchbrechen und etwas für die Wiederaufnahme genealogischer Studien zu thun. Von meinem Theile kann ich die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen ohne zu bekunden, daß ich bei zahlreichen Vertretern wissenschaftlicher Zweige, deren ich in vielen einzelnen Fällen annerkennungsweise zu gedenken hatte, und die ich bitte, hier ein für allemale meinen Dank entgegen zu nehmen, auch heute schon ein sehr entschiedenes Interesse für die Fragen wahrgenommen habe, zu deren Lösung die Genealogie einiges beitragen möchte. Auch fand mein Versuch bei einem jungen tüchtigen Vorkämpfer genealogischer Forschung, Ernst Devrient, mitarbeitende Theilnahme. (VI ≡)
Und so geht dieser genealogische „Gatterer“ nach hundert Jahren neuerdings mit Wunsch und Erwartung in die Welt, im nächsten Jahrhundert doch noch eine Renaissance zu sehen. Rom, im December 1897.
(VII ≡)
Inhalts-Verzeichniß.
Einleitung.Genealogie als Wissenschaft.
Erster Theil.Die Lehre vom Stammbaum.
Zweiter Theil.Die Ahnentafel.
(IX ≡)
Dritter Theil.Fortpflanzung und Vererbung.
(1 ≡)
Einleitung.
Genealogie als Wissenschaft.
(2 ≡)
(3 ≡)
Begriff der Genealogie.Die Erkenntnis von dem Zusammenhange lebender Wesen in Folge von Zeugungen der einen und Abstammung der andern kann im allgemeinsten Sinne als die Grundlage alles dessen angesehen werden, was unter Genealogie zu verstehen ist. Sie umfaßt in dieser weiten Bedeutung des Wortes die gesammte geschlechtlich fortgepflanzte Thierwelt und findet ihre Anwendung in Bezug auf alle Gattungen und Arten derselben. Für die objektiv wissenschaftliche Betrachtung bietet sich jedes geschlechtlich erzeugte Wesen als Gegenstand genealogischer Forschung dar und jede Erforschung des Lebens erlangt unter diesem Gesichtspunkte den Charakter einer genealogischen Wissenschaft. Indessen ergiebt sich zwischen den Objekten der auf Zeugung und Abstammung gerichteten genealogischen Betrachtung ein wesentlicher Unterschied in Folge des Bewußtseins des Zusammenhangs zwischen Erzeugern und Erzeugten. Das Thier erkennt seine Eltern vermöge des Bedürfnisses der eigenen Lebenserhaltung während eines Zeitraums, dessen Dauer von der Höhe der Entwicklung seiner Gattung abhängig ist, aber erst beim Menschen beginnt eine von dem unmittelbaren Trieb des Lebens unabhängige Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Eltern und Kindern: In der Stufenfolge organischer Wesen gelangt man endlich zu gewissen Arten von Menschen, welche sich durch das allgemein vorhandene genealogische Bewußtsein von den Thieren und wahrscheinlich auch von andern Arten deutlich unterscheiden lassen, die nach sonstigen Eigenschaften ihnen menschlich nahe verwandt erscheinen mögen. Eine sichere anthropologische Kenntnis davon, bei (4 ≡)
welchen Arten von Menschen, unter welchen Rassen und Himmelsstrichen das genealogische Bewußtsein sich entwickelte, ist zur Zeit nicht vorhanden. Man kann nur sagen, daß überall da, wo sich unter Menschen Erinnerungen an vergangene Menschen bewahren, genealogisches Bewußtsein vorhanden ist, und daß daher die ältesten geschichtlichen Ueberlieferungen, die bei den verschiedensten Völkern gefunden wurden, meistens genealogischer Natur waren. Die Genealogie im engeren und eigentlichen Sinne setzt mithin das Vorhandensein des genealogischen Bewußtseins jener besonderen Wesen voraus, deren Zusammenhang unter einander auf Erzeugung und Abstammung erkannt werden soll. Die Genealogie als Wissenschaft kann nur von denjenigen Lebewesen gedacht werden, die die Vorstellung von Eltern und Kindern in der Besonderheit der Fälle zu erhalten gewußt haben. Sie setzt voraus, daß das Individuum in seiner Abstammung von Individuen erkannt worden ist und begnügt sich nicht mit einer Erkenntnis des Zusammenhangs und der Entwicklung von Arten überhaupt. Im Gegensatze zu dem Gattungsbegriff und seiner Evolution steht die Genealogie auf dem Individualbegriff und alle von ihr zu beobachtende Entwicklung kann nur im collectiven Sinne verstanden werden. Sie hat es nicht mit dem Menschen überhaupt, sondern mit den geschichtlich handelnden, durch Zeugungen fortgepflanzten Personen zu thun, die sich des Zusammenhanges von Eltern und Kindern bewußt geworden und zur Erkenntnis einer Reihe zeitlich entwickelter Thatsachen gekommen sind, welche durch die Geburt und den Tod jedes einzelnen Individuums deutlich erkennbar begrenzt sind. In dieser Abfolge von Ereignissen bilden sich die Erinnerungen des geschichtlichen Menschen als Wirkungen von Lebensaltern oder Generationen, und das sich erhaltende und stets erneuernde Bewußtsein von Abstammungsreihen, die Erkenntnis immer wiederholter und neu geborener Generationen von Vätern, Söhnen und Enkeln ist hinwieder das Kennzeichen von gewissen Menschenarten, die man zum Unterschiede von allen andern Lebewesen den Geschichtsmenschen nennen darf. Wo immer der Naturforscher in Rücksicht auf die Eigenschaften der gesammten Thierwelt das unterscheidende in den Arten aufsuchen und feststellen mag, (5 ≡)
unter allen Umständen wird er an eine Grenze gelangen, wo das genealogische Bewußtsein unter den Menschenarten zuerst auftritt und die Erkenntnis der Geschlechtsreihen im Gegensatze zur Thierwelt in lebendiger Vorstellung forterbt. Kann er in den natürlichen Vorgängen der Fortpflanzung zwischen den geschlechtlichen Zeugungen keinen wesentlichen Unterschied bemerken, so tritt in dem Bewußtwerden des genealogischen Begriffs ein Individuum hervor, dessen Wirkungen mit denen keiner andern Art von Lebewesen vergleichbar sind. In diesem Sinne erscheint das Auftreten des genealogischen Bewußtseins unter den Menschen nicht bloß als ein Hilfsmittel, welches die geschichtliche Erinnerung begleitet oder erleichtert, sondern vielmehr als die Ursprungsquelle alles geschichtlichen Lebens und Denkens. Es ist daher ganz richtig, wenn schon der alte Gatterer, der sich rühmen durfte, der erste gewesen zu sein, welcher ein systematisches Buch über die Genealogie geschrieben, sagte: „Genealogie gab es eher unter den Menschen als Geschichte.“ Und mit gleichem Rechte hob er es als besonders merkwürdig und bezeichnend hervor, daß man, sobald der Gedanke von Genealogie in der Menschenseele erwacht war, sofort darauf verfiel, Stammtafeln der Götter zu machen, bevor man noch Stammtafeln der Menschen besaß. Selbst die Weltschöpfung, die man personifizirte, konnte nur genealogisch gedacht sein; in der That eine frühzeitige Ahnung der Völker davon, daß hier etwas notwendiges und gesetzliches zu Grunde liege, welches keinen anderen historischen Vorstellungen und Erinnerungen in gleichem Maße zuzukommen schien. Denn was man auch von Menschen und ihren Erlebnissen und Handlungen sonst wissen und erzählen konnte, etwas gleich sicheres, stets wiederkehrendes, durchaus gesetzmäßiges, wie Geburt und Tod, wie die Aufeinanderfolge der Geschlechter, wie Zeugung und Abstammung ist bei Beobachtung aller den Menschen betreffenden und vom Thun der Menschen abhängigen Ereignissen nicht zu erkennen gewesen. Seit den urweltlichen Zeiten des entstandenen menschlichen Bewußtseins drängte sich die genealogische Erkenntnis als ein etwas der Erfahrung auf, das sich als dauerndes im Wechsel der Erscheinungen erweisen mußte. In diesem Sinne gehörte die Genealogie zu (6 ≡)
den ältesten Erfahrungen des Menschengeschlechts, denen in der Einfachheit ihrer Sätze der Charakter einer Wissenschaft nicht abzusprechen war, denn was sie feststellte, beruhte auf der allgemeinen und unbedingten Giltigkeit ihrer Erkenntnisse, gleichwie die Wahrheiten des Sternenlaufes und die Beobachtungen an Sonne und Mond. Gleichwie sich die astronomischen Wissenschaften als Erbtheil der ältesten Völker aus der Beobachtung des Weltalls ergeben haben, so entwickelte sich die Genealogie als ein Ergebnis der Betrachtung des menschlichen Daseins. Es bedarf nicht erst des Hinweises auf das Schriftthum, das seit Moses zu Gebote steht. Die Genealogie ist in diesem ursprünglichsten Sinne mithin die Wissenschaft von der Fortpflanzung des Geschlechts in seinen individuellen Erscheinungen. Sie erhält ihren vollen Inhalt und ihr eigentliches Gepräge durch die Beobachtung eben des in seinen persönlichen Zeugungs- und Abstammungsverhältnissen erkannten Menschen selbst, der in Rücksicht auf seine physischen, geistigen und gesellschaftlichen Eigenschaften einer Reihe von Veränderungen unterliegt, deren Erkenntnis im einzelnen zwar zu den Aufgaben anderer selbständiger Wissenszweige gehört, an deren Grenzen jedoch die Genealogie diejenigen Ursachen und Wirkungen untersucht, welche sich auf Zeugung und Abstammung des Individuums in seiner Besonderheit beziehen.
Stellung der Genealogie in den Wissenschaften überhaupt.Eine sehr verschiedene Bedeutung gewinnt die Genealogie durch ihre Beziehungen zu der Gesammtheit der Wissenszweige. Auf sich selbst gestellt und in sich beruhend erscheint die Genealogie nur da, wo sie in der Darstellung lediglich die Thatsachen individueller Zeugungs- und Abstammungsverhältnisse berücksichtigt. Wendet sie sich dagegen zur Betrachtung der Natur und des Wesens der Erzeugten, so tritt sie in vielfache Beziehungen zu einer Reihe von Wissenschaften, deren Untersuchungen sich nur zum Theile mit den Aufgaben der Genealogie decken werden, denen sie jedoch (7 ≡)
überall hilfswissenschaftlich zur Seite stehen kann. So läßt sich die Genealogie ihrem Begriff und Wesen nach in zwei Hauptrichtungen gliedern, je nachdem man ihre formale Seite in der Nachweisung thatsächlicher Geschlechtsverhältnisse ins Auge faßt, oder aber stofflich und inhaltlich die Beziehungen untersucht, die sie zu andern Wissensgebieten darbietet. In ersterer Rücksicht – man mag den Ausdruck formaler Genealogie, wenn er auch nicht sehr bezeichnend ist, der Kürze und Bequemlichkeit wegen nicht misbilligen – handelt es sich um Darstellung von Abstammungsverhältnissen und Verwandtschaften einer gewissen Anzahl persönlich zu bezeichnender Menschen in aufsteigenden und absteigenden Zeugungs- oder Geschlechtsreihen. Bei dieser ein für allemale wichtigsten, grundlegenden Thätigkeit kommt es in der genealogischen Wissenschaft zunächst darauf an, die durch Zeugung und Abstammung bedingten Verhältnisse von bestimmten Personen zu bestimmten Personen richtig zu erkennen und klar nachzuweisen. Man gelangt auf diesem Wege zu einem System von reihenweis fortschreitenden, aufsteigenden oder absteigenden Linien, aus welchen sich der Begriff der Generationen entwickelt. In diesem eigentlichen und besonderen Sinne fällt der Genealogie die Aufgabe zu, die Vielheiten menschlicher Zeugungsakte unter einheitliche Gesichtspunkte des Abstammungsverhältnisses von bestimmten Menschenpaaren zu bringen, welche in ihrer zeitlich begrenzten Wirksamkeit als Urheber von bestimmt bezeichneten, ebenfalls zeitlich begrenzten durch die gleiche Abstammnng geschwisterlich vereinigten Personen erkannt sind und in immer neu sich bildenden Reihen zu Stammeltern eines im Zeitenstrom sich fortentwickelnden Geschlechts werden. Die Genealogie beschäftigt sich in elementarer Arbeit zunächst mit dem Generationsbegriff als Ausfluß unmittelbar nachzuweisender Zeugungen und kann zunächst von der Frage absehen, inwiefern auch im weiteren Sinne von Generationen gesprochen werden kann, bei denen aus zeitlich zusammenfallenden Lebenswirksamkeiten gleichsam auf eine Stammvaterschaft idealer Art und auf eine Zusammengehörigkeit von Abstammungsreihen geschlossen werden kann. Im weitesten Sinne des Begriffs fällt die Vorstellung von Generationen aus dem Rahmen genealogischer (8 ≡)
Nachweisung selbstverständlich heraus, beruht eigentlich auf der Hypothese einer Abstammung von einem Elternpaar und erhält ihre Bedeutung erst in ihrer Anwendung auf anderen Gebieten historischer Erscheinungen. Indessen sind die Aufgaben, welche der Genealogie schon auf ihrer untersten Stufe in dem Nachweise bloßer Zeugungs- und Abstammungsverhältnisse gestellt sind, schwierig genug zu erfüllen. Denn das Erinnerungsvermögen der Menschen ist in Bezug auf diese ohne Zweifel natürlichsten Vorgänge, auf denen ihr Dasein doch beruht, wenngleich besser als bei den Thieren, doch im ganzen und großen ebenfalls ein außerordentlich geringes und ungewisses. Die sichere Kenntnis von Abstammungsverhältnissen setzt nicht nur einen hohen Grad erlangter ethischer Kultur, sondern auch den ausgedehnten Gebrauch der Schrift voraus. Ohne diese giebt es so wenig eine Genealogie, wie eine Geschichte, diese vielleicht noch eher, als jene. Aber auch das schriftliche Zeugnis ist nur ein, wenn auch unentbehrlicher Nothbehelf in genealogischen Dingen, sobald man denselben in größerem Umfange nachgeht. Das Erinnerungsvermögen in Bezug auf Abstammungsverhältnisse reicht bei den Menschen bis zu den Großeltern und in besonders günstigen Verhältnissen bis zu den Urgroßeltern. Die mündliche Ueberlieferung kann ganz zuverlässige Mittheilungen über einzelne Linien von Vorfahren darbieten, aber für die Erkenntnis von Geschlechtsreihen reicht kein Gedächtnis aus. Und selbst das schriftliche Zeugnis unterliegt einem gewissen Skepticismus in genalogischen Dingen, der trotz selbstverständlicher Anwendung aller jener Mittel und Methoden, die man in den geschichtlichen Wissenschaften überhaupt besitzt, vermöge der eigenthümlichen Natur genealogischer Thatsachen unbesiegbar sein mag. Trotz aller Feinheiten geschichtlicher Untersuchung, trotz aller Fortschritte des historisch-kritischen Geistes unserer Zeit, wird der Genealog immer nur Sätze auszusprechen vermögen, zu deren Annahme die Bereitwilligkeit des Glaubens und Vertrauens gehört. Zu einer exakten Wissenschaft, die sich auf dem[GWR 5] Standpunkt des experimentellen Beweises befände, kann es die Genealogie nicht bringen, da sie Geheimnisse in sich verbirgt, die keine Kritik enträthseln kann. Der verbreitete Hochmuth des historischen (9 ≡)
Calculs kommt sicherlich nie öfters zu Falle, als selbst bei den sorgfältigst erforschten Thatsachen dieses menschlich so unsicheren Gebietes. Ob die genealogische Wissenschaft aus sich selbst heraus zu Methoden vorzudringen vermöchte, nach welchen ihre dunklen Seiten mehr zu erhellen wären, dies erfordert eine Ueberlegung, die weit schwieriger sein wird, als die handwerksmäßigen Erörterungen über Geburtszeugnisse und Sterberegister. Indem sich die wissenschaftliche Genealogie diese weit über das Gebiet ihrer formalen Aufgabe hinausschreitende Frage vorlegt, steht sie mitten in den Beziehungen, die sich ihr aus der stofflichen Betrachtung ihrer Gegenstände zu den mannigfaltigsten Zweigen historischer, politischer und naturwissenschaftlicher Disziplinen ergeben werden. So lange sie auf dem Standpunkt der formalen Feststellung der Zeugungs- und Abstammungsverhältnisse stehen bleibt, brauchten sich ihre Ergebnisse wenig von einander zu unterscheiden, sei es, daß sie sich mit menschlichen oder thierischen Individuen beschäftigt; indem sie aber daran geht, die natürlichen und qualitativen Veränderungen derselben mit zu beobachten, erhebt sie sich zu einer Wissenschaft vom Menschen und seiner Geschichte im Besonderen. Auf diesem Wege ersteigt sie den Gipfel ihrer Einsicht in der Erkenntniß der individuellen Unterschiede der sich fortpflanzenden Geschlechter, und betheiligt sich auf dieser Höhe ihrer Forschungen an der Lösung von Fragen, die von den verschiedensten Seiten her wissenschaftlich angestrebt wird. Sie wandelt auf den Grenzlinien des geschichtlichen und naturwissenschaftlichen, wie des staats- und rechtswissenschaftlichen Gebiets. Will man sie als Hilfswissenschaft bezeichnen, so versteht sich dies im weitesten Umfange der Disziplinen des sogenannten Natur- und Geisteslebens. Indem sie sich den mannigfaltigsten Wissenschaftsgebieten anzuschmiegen und zu unterordnen vermag, unterscheidet sie sich jedoch in ihrer Art von allen übrigen zugleich dadurch, daß sie niemals von dem individuellen Charakter ihrer gesammten Betrachtungen abzusehen und abzugehen vermag. Sie beschäftigt sich immer mit dem Einzelnen und gestattet keine Verallgemeinerung nach Art jener Wissenschaften, die durch die Abstraktion zur Erkenntnis gesetzlich festgestellter Thatsachen vordringen. Die Genealogie geht von dem (10 ≡)
einzelnen Fall aus und behandelt auch nur den einzelnen Fall. Was allen Fällen gemeinschaftlich ist, ist nichts als ein leeres Schema, eine Form, eine Voraussetzung für Erkenntnis von Gesetzen, welche vielleicht die Geschichte, die Gesellschafts- und Staatswissenschaft, wahrscheinlich die Biologie und Anthropologie, jedenfalls die Physiologie und Psychologie auszudenken und aufzustellen im Stande sein werden.
Genealogie und Geschichte.Wenn die ältesten geschichtlichen Erinnerungen der meisten Culturvölker genealogischer Natur waren, so erweiterte sich alsbald die Genealogie zur Geschichte der Völker selbst, indem sie in das Knochengerüste ihrer Geschlechtsreihen den gesammten Inhalt des historischen Lebens derselben willig und gleichsam unwillkürlich aufnahm. Das genealogische System trat in Concurrenz mit dem der Chronologie und ergänzte das letztere. Auf dem Standpunkte der Entwickelung astronomischer Beobachtungen vermochte die Annalistik sich auszubilden, die vorherrschend genealogische Betrachtungsweise förderte die epische Erzählung unter wesentlicher Vernachlässigung chronologischer Momente. Die eigentliche Geschichte konnte sich nicht entwickeln ohne gleichwertige Betrachtung und gleiche Bewertung der chronologischen wie der genealogischen Grundlagen des wirklichen Geschehens. Wenn sich nun aber die Geschichte erzählend und berichtend zu immer reinerer Darstellung der Handlungen und Wirkungen erhebt und das gesammte Interesse auf das Gegenständliche der Entwicklung hinleitet, so büßt die Genealogie ebenso wie die Chronologie ihre leitende Stellung mehr und mehr ein und sinkt zur Dienerin, zur Hilfswissenschaft herab. In dieser Form begleitet sie in Zeiten hoher Vervollkommnung den geschichtsforschenden Geist fortgeschrittener Nationen und je mehr die Kunstgebilde historischer Darstellung verfeinert in der Litteratur erscheinen, desto weniger scheint die Stammtafel noch einen in sich ruhenden Werth besitzen zu können. Die Genealogie theilt dann das Schicksal des chronologischen Schemas, der Annalistik, welche (11 ≡)
von einer abgezogenen Wissenschaftlichkeit bis zur Verwirrung des thatsächlichen vernachlässigt werden konnte. Indessen vermag doch alle Geschichtsbaukunst, sei sie auch noch so sehr auf die rein sachlichen Fragen und Gesichtspunkte gerichtet, auch noch so sehr den politischen, litterarischen, culturellen und sozialen Entwicklungen zugewandt, die genealogische Grundlage und mit dieser das genealogische Interesse nicht ganz zu verdrängen. Still und in sich gekehrt behauptet die Geschlechtskunde zunächst im engen Kreise von Familienerinnerungen und da es die Familie ist, die sich als solche im Gange des Geschichtslebens mächtiger und mächtiger zu regen versteht, als solche in der Gemeinde, im Volke, im Staate allgemach entscheidend aufzutreten vermag, so drängt sie sich der Geschichtswissenschaft wieder mit ihrer genealogischen Grundlage bedeutend auf und nötigt den Erzähler von Heldenthaten und Geistesschlachten, ebenso wie den Erklärer von Staatseinrichtungen, Verfassungen und Kunstwerken sich wieder in den Dienst der Genealogie zu stellen und ein gutes Stück von Weisheit und Kraft aus dem Mark und den Thaten von Stammvätern und Vorfahren herzuleiten, die wieder nur aus der Ahnentafel erkannt werden können. Das Verhältnis, in welches die Genealogie zur Geschichte sich stellt, ist äußerlich genommen leicht verständlich und in hilfswissenschaftlichem Sinne im allgemeinen nicht unbeachtet geblieben; aber indem sich die genealogischen Fragen im Hinblicke auf das, was der Sohn vom Vater, die absteigenden Geschlechter von den Vorfahren überkommen haben, mächtig in den Aufbau geschichtlicher Ursachen und Wirkungen hineinschieben, befindet sich die Forschung auf einem Gebiete, welches zu größerer Erhellung aufzufordern scheint. Daß alles menschliche Wollen und Thun aus Quellen fließt, die in einem genealogisch zu erforschenden Boden liegen, kann wol an keiner Stelle von dem Geschichtsforscher verkannt werden, wenn auch eine Erkenntnis einzelner Umstände in dieser Beziehung schwierig, zuweilen unmöglich sein mag. Aber die Geschichte darf von der Genealogie Aufklärungen erwarten, die vielleicht noch mehr nach dem zu beurtheilen sind, was sich als Aufgabe darstellt, als was darin bereits geleistet worden sein mag. (12 ≡)
Die mannigfaltigsten Erscheinungen des geschichtlichen Verlaufs der Dinge im Staat und in der Gesellschaft, wie in der Litteratur und Kunst sind Wirkungen nicht nur von einer Person und nicht nur von einer Reihe gleichzeitig lebender Menschen, sondern auch Ergebnisse der Thätigkeit einer Anzahl hintereinander auftretender Generationen, die sich, weil Väter, Söhne und Enkel in einem geistigen wie körperlichen Zusammenhange stehen, nur als Produkte genealogisch wirkender Kräfte erfassen lassen. Der klare Begriff des geschichtlichen Werdens ergibt sich aus dem, was durch die sich fortpflanzenden und erneuernden Geschlechtsreihen hervorgebracht worden ist, was von den einen erworben und erlangt, von den andern übernommen und an's Ende geführt worden ist. Keine geschichtliche Betrachtung kann von dem Zusammenwirken der in Familie, Stamm und Volk verbundenen und in gewissen genealogisch festzustellenden Verbindungen thätigen Persönlichkeiten absehen; alle Geschichte ist Familien-, Stamm- oder Volksgeschichte und kann als solche den Begriff der Generation nicht entbehren. Der Familienstammbaum theilt sich nach der Abfolge von Eltern und Kindern und verzweigt sich nach den von den Geschwistern ausgehenden Linien und der Stammbaum des Volkes schreitet in Generationen fort, welche als ein ideales Schema für die Gesammtheit der in Familien, Stämmen und Völkern vereinigten Menschen gedacht werden, aus welchen jedoch die Genealogie nur einzelne durch Persönlichkeit ausgezeichnete Bestandtheile darstellend herausgreift. Je bestimmter sich aber der einzelne Stammbaum als Typus der historisch wirksamen Generationen erfassen läßt, desto sicherer wird er dem Historiker als Grundlage für seine Beobachtung der Entwicklung gelten dürfen. Der geschichtliche Prozeß schreitet generationsweise fort und findet sein zeitliches Maß in den genealogisch erkennbaren Geschlechtsreihen bestimmter Personen und namentlich festzustellender Abstammungen. So mannigfaltig auch der Begriff der Generation von den verschiedensten Wissenschaften, bald von der Statistik und Bevölkerungslehre, bald von der Philosopie der Geschichte, bald von der Zoologie und Anthropologie gefaßt werden wollte, eine sichere Grundlage erhält derselbe nur durch die Genealogie, denn er bedeutet nichts anderes als das durch den (13 ≡)
Stammbaum persönlich ausgefüllte Schema der menschlichen Zeugungen und Fortpflanzungen. In dieser abgezogenen den realen Zusammenhängen der einzelnen Familien entnommenen Bedeutung bietet der Begriff der Generation dem Geschichtsforscher den sicheren Wegweiser, welchen der alte Weltweise schon mit dem Satze bezeichnet: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Indessen ist die Beziehung der Genealogie zur Geschichte keineswegs durch die Erklärung dessen, was man die Generationslehre nennen darf, erschöpft. Und obwol Ranke der Idee einer generationsweisen Entwicklung die grundlegende Stellung gesichert hat, so bezeichnet dieses Ziel genealogischer Studien doch mehr die Aufgaben geschichtlicher Zukunftswissenschaft, als die gewohnten Beziehungen des wissenschaftlichen Betriebes. Dagegen ist die Genealogie in ihrer Bedeutung für die politische Geschichte zu allen Zeiten im wesentlichen richtig erkannt worden. Der Zusammenhang genealogischer und politischer Dinge ist dem Erzähler von Weltbegebenheiten klar gewesen, so lange es Volkshäupter und Herrschergeschlechter gegeben hat, und so lange ständische Gliederungen von was immer für einer Art, führende Persönlichkeiten unterscheidbar machten. Die Staatengeschichte kann so wenig von der Kenntnis ihrer genealogischen Voraussetzungen losgelöst werden, wie die Geographie von der Landkarte. Es giebt eine Behandlungsweise des genealogischen Stoffes, die mit der politischen Geschichte vollständig zusammenfällt und es gibt staatsgeschichtliche Vorgänge, die überhaupt nichts als genealogische Fragen sind. Die Geschichtsforschung und Geschichtserzählung aller Völker läßt einen nicht seltenen Wechsel in der Wertschätzung der genealogischen Verhältnisse wahrnehmen, die Staatsformen und Verfassungseinrichtungen, die sich dem Geschichtsforscher darbieten, nehmen einen im Gegenstand begründeten Einfluß auf die genealogische Behandlung der Geschichte selbst; die Betrachtung monarchischer und aristokratischer Entwickelungen nöthigt in bestimmterer Weise zur Berücksichtigung des genealogischen Momentes, als die Darstellung republikanischer und demokratischer Einrichtungen. Aber seit man erfahren, daß auch die römische Republik ihren genealogischen Grundzug behalten und ihre Geschlechtergeschichte zum Verständnis (14 ≡)
der Staatsverhältnisse unerläßlich war und seit man weiß, daß das große Parteiwesen Englands auf vorherrschend genealogischen Grundlagen ruhte, würde es als eine Thorheit betrachtet werden müssen, diesen freiesten Völkerentwicklungen ohne die Leuchte der Genealogie nahen zu wollen. Die Geschichte der Staaten der neueren Zeit ist in Absicht auf ihre geographische Existenz und in Betreff aller Dinge, die unter den Gesichtspunkt internationaler Verhältnisse fallen, überhaupt genealogischer Natur und da man von Geschichte im höchsten und eigentlichsten Sinne doch eben nur bei jenen Culturvölkern zu sprechen pflegt, die sich in den neueren Zeiten bethätigt haben, so versteht sich von selbst, daß thatsächlich alle moderne Geschichtsdarstellung sich im Geiste der Autoren theils bewußt, theils unbewußt auf dem Schema, wie auf dem persönlichen Aufbau der Stammbäume emporheben konnte; es ist immer nur eine methodische Frage für den Historiker, ob er die natürliche Grundlage des menschlichen Daseins und mithin auch alles menschlichen Thuns, das genealogische Gerüst der Familien und der Gesellschaft ganz oder nur theilweise aufgedeckt dem Hörer oder Leser seiner Erzählungen vorführen will. Im Bestreben, den von der Geschichte zu meldenden Thatsachen eine möglichst objektive Giltigkeit zuzuerkennen, ist der genealogische Bestand des geschichtlichen Stoffes gerade durch die vollkommeneren Beiträge der Historiographie immer mehr zurückgedrängt worden. Den künstlerischen Aufgaben geschichtlicher Darstellungen sagte die zum Theil eintönige Betrachtung von Zeugungs- und Abstammungsverhältnissen oft weniger zu, als die gleichsam innerlich begründete Verknüpfung der Ereignisse der Weltgeschichte selbst. Und wiewol es stets ein Beweis ganz besonderen Talents war, wenn Geschichtsschreiber in weiser Oekonomie ihrer Mittheilungen das persönlich genealogische in sichere Verbindung mit dem objektiv thatsächlichen zu setzen verstanden haben, so kann man doch nicht verkennen, daß der Gang der historiographischen Entwicklung der genealogischen Erkenntnis im letzten Jahrhundert weniger günstig war, obgleich doch auf der einen Seite die genealogische Forschung bei gänzlicher Abseitsstellung in Betreff einzelner Familienbesonderheiten große Fortschritte aufzuweisen (15 ≡)
und andererseits die Geschichtsforschung in Betreff alles thatsächlichen der Begebenheiten und in der Erkenntnis des Zuständlichen einen ungeheuren Aufschwung genommen hat. Die starke und mächtige Verknüpfung zwischen den genealogischen und staatsgeschichtlichen Momenten ist dagegen zurückgetreten und in einige Vergessenheit gerathen. Als der bedeutendste Schöpfer und Lehrer einer genealogisch begründeten Staatsgeschichte stand vor fast zweihundert Jahren Johann Hübner in Hamburg auf, einer der größten und gewaltigsten Geschichtsdenker im historiographischen Salon der Zurückgewiesenen und Vergessenen. Er hat nicht nur die umfassendsten Grundlagen für die Genealogie im speciellen geschaffen, sondern auch den rechten Weg für eindringendes Verständnis und Studium der politischen und Rechtsgeschichte gewiesen. In Folge seiner vortrefflichen Methoden besaß das 18. Jahrhundert eine sehr sichere staatsgeschichtliche Thatsachenkenntnis ohne jede Phraseologie und aufdringliche Hervorkehrung der idealen Beziehungen. Wiewol nun zuweilen hierin eine, große Geister, wie Voltaire oder Friedrich den Großen beleidigende Steifheit der Auffassung erreicht worden sein mag, so kann man doch sagen, daß besonders der praktischen Staatskunst diese sichere genealogische Geschichtskenntnis zu Gute kam und die große Zahl eminenter diplomatischer Talente des 18. Jahrhunderts ohne Frage mit dem trefflichen auf der Genealogie beruhenden Geschichtsunterricht zusammenhing. Die Göttinger historische Schule und besonders Pütter war sich dieses Zusammenhangs und dieses Erfolgs des genealogisch-staatswissenschaftlich-geschichtlichen Lehrvortrags dann auch vollkommen bewußt. Derselbe beruhte eigentlich auf dem von Johann Hübner begründeten System genealogischer Erklärung der Staatsgeschichte, welches derselbe in dem Werke: „Kurtze Fragen aus der Genealogie nebst denen darzu gehörigen Tabellen zur Erläuterung der politischen Historie“ darlegte. Gatterer und Pütter schlossen sich in ihren Vorlesungen noch ganz genau diesem System an und des letzeren Tabulae genealogicae ad illustrandam historiam imperii blieben lange Zeit das unentbehrlichste und benützteste Hilfsmittel historischen Unterrichts. Wenn seit Schlosser und Johannes Müller dieselbe Methode wenigstens in der Litteratur (16 ≡)
der Lehrbücher zurückzutreten schien, so möchte man der Vermutung Raum geben können, daß diese Männer den Gebrauch der Stammtafel vermöge des von ihnen noch genossenen Unterrichts als etwas so selbstverständliches betrachteten, daß sie sich auf die älteren Werke ausreichend stützen zu können meinten. Leider hielt aber das genealogische Studium selbst im weiteren Verfolg der historiographischen Entwicklung nicht gleichen Schritt. Einzelne Darsteller der Weltgeschichte, wie Damberger, waren noch von der Nothwendigkeit der genealogischen Tafeln überzeugt und ein ebenso gelehrter wie ausgezeichneter Forscher, wie J. Richter machte sogar noch den gewagten Versuch, durch ein genealogisches Werk von hervorragendster Bedeutung zur römischen Geschichte die der Genealogie besonders abgeneigten Philologen für das ältere System zu gewinnen, aber er scheiterte bereits an der Gleichgültigkeit der neuen Gelehrten für diese Dinge und fast ist es dahin gekommen, daß das Bewußtsein des Zusammenhangs von Genealogie und geschichtlicher Entwicklung in der großen Menge der historischen Litteratur verloren ging. Das von Oncken herausgegebene Werk der Weltgeschichte lieferte endlich den Beweis, daß in einer gewaltigen Zahl von Bänden eine Reihe von Gelehrten sich vereinigen konnte, die mannigfaltigsten künstlerischen Hilfsmittel herbeizuziehen, um das Verständnis geschichtlicher Dinge zu erleichtern, aber nicht eine einzige Stammtafel beizufügen für nötig fand! Auch haben die zahlreichen Akademieen und gelehrten Gesellschaften, die in den letzten fünfzig Jahren unendliche Summen für zum Theil recht unbedeutende Publicationen ausgegeben haben, nicht ein einziges Werk genealogischen Inhalts und Charakters zu Tage gefördert oder unterstützt, obwohl doch die großen Leistungen der älteren Zeit zu Fortsetzungen aufgefordert hätten, die sicher nur durch die Thätigkeit von gelehrten Körperschaften zu Stande kommen konnten. Der Verfasser des vorliegenden Werkes hat seit längerer Zeit in Schrift und Wort für die Notwendigkeit der Wiederaufnahme genealogischer Studien und Arbeiten zum Zwecke der Herbeiführung entsprechenderer geschichtlicher Kenntnisse gestritten, hat aber fast nur Widerspruch von Seiten der historischen Gelehrsamkeit und insbesondere von den ihm meist feindseligen, tonangebenden, die (17 ≡)
öffentlichen und privaten Mittel der verschiedensten Gesellschaften verwaltenden Leitern historischer Unternehmungen erfahren. Die genealogisch-historische Forschung sieht aber auf eine große Vergangenheit zurück und wird als wichtiges Gebiet historischer Forschung im zwanzigsten Jahrhundert ohne Zweifel wieder auferstehen. Genealogie, Staatswissenschaft, Gesellschaftslehre, öffentliches und privates Recht.Der große Staatsrechts- und Geschichtslehrer Johann Stephan Pütter, dessen Lehr- und Handbücher bis auf unsere Tage unübertroffen geblieben sind und dessen Methode unerschüttert feststeht, wie der Polarstern, hat schon vor mehr als hundert Jahren jedem seiner Schüler die ebenso einfache als zuverlässige Wahrheit eingeschärft, daß sich in Staatssachen und Rechtsverhältnissen seit die Menschen Eigenthumsbegriffe mit Erbschaftsbegriffen verbunden hätten, ohne genealogische Grundlage keinerlei Wissenschaft und keinerlei Rechtssystem entwickeln konnte. In seinem schon erwähnten Werke zur Erläuterung der Rechtsgeschichte weist er besonders darauf hin, daß das öffentliche Recht überhaupt und das besonders in Deutschland ausgebildete Fürstenrecht ohne Einsicht und Studium der Genealogie nicht verstanden werden können. Aber auch das von den Römern ausgebildete Privatrecht nötigte zu der genauesten Erwägung genealogischer Fragen und brachte eine genealogische Systematik hervor, die ihrerseits wiederum auf die Entwicklung der Genealogie als Wissenschaft zurückwirkte. Den Erbschaftsfragen des Privatrechts steht die Erbfolgefrage des öffentlichen Rechts zur Seite und die juristische Entscheidung des Streitfalles setzt den Nachweis und die Sicherstellung genealogischer Thatsachen im Privatrecht wie im öffentlichen voraus. Die Vernachlässigung der genealogischen Studien schien im Beginn des Jahrhunderts mit den Einflüssen der französischen Revolutionsideen auf die Rechts- und Staatsentwicklung im Zusammenhange zu stehen. Eine gewisse Theilnahmslosigkeit für Fragen des Fürstenrechts und in Folge dessen eine geringe Kenntnis der Erbfolgefragen zeigte sich sowohl in den Staatsangelegenheiten, (18 ≡)
wie auch in der geschichtlichen Behandlung vergangener Erbfolgefragen. Aber der eherne Bestand gewisser unveräußerlicher Rechte wurde dadurch nicht berührt und das zu Ende gehende Jahrhundert läßt genealogische Streitfragen zur Entscheidung kommen, von denen mancher Politiker geglaubt hat, daß sie nicht leicht mehr eine praktische Bedeutung haben könnten. Die Vorstellung, daß die Genealogie nur rückwärts gekehrt für vergangene Jahrhunderte eine Hilfswissenschaft bilden werde, zeigt sich als ein Irrthum der sozialdemokratischen Lehre, die sich von den natürlichen Grundlagen des menschlichen Daseins, wie der Gesellschaft emancipiren zu können meint. Das genealogische Bewußtsein der Gesellschaft ist vielmehr durch die Erkenntnis natürlicher Vorgänge und durch den steigend naturwissenschaftlichen Geist der Zeit trotz aller entgegengesetzten Theorien lebhafter erwacht, als jemals seit den Zeiten der französischen Revolution. Die Auffassung der Gesellschaftszustände zieht heute ihre Nahrung weniger aus der Hochachtung vor den ständisch gegliederten Classen, welche in der Genealogie zum Ausdruck kommen, als vielmehr aus der Erkenntnis der natürlichen Beschaffenheit und den genealogisch entwickelten Eigenschaften der Geschlechter. Unter diesem Banner kämpft die wissenschaftliche Genealogie heute gegen die sozialen Lehren, wie ehemals die Aristokratie gegen die Demokratie. Das was gleichwertig geblieben ist, ist die Vorstellung von der Wichtigkeit der genealogischen Verhältnisse für den Aufbau und Bestand der Gesellschaft; die genealogischen Verhältnisse sind nur ehedem mehr in ihrem mehr äußerlichen politischen und ständischen Charakter und heute mehr von ihrer biologisch-physiologischen Seite gewürdigt worden. Der genealogisch zu erkennende Grundcharakter aller Gesellschaftslehre – die genealogische Wissenschaft in ihrem Wesen bleibt unberührt von allen zeitlichen Wandlungen dessen, was die Geschlechter als solche jeweils für das wertvollere und wichtigere gesellschaftliche Moment erachtet haben. Kein Mensch kann aus seinen Zeugungs- und Abstammungsreihen herausspringen, mag er sich diese oder jene soziale Theorie zurechtmachen. Auf den Verhältnissen seiner Vorfahren und Nachkommenschaft beruht die Stellung, die er in der Gesellschaft einnimmt, er kann sich körperlich und geistig noch viel weniger als (19 ≡)
ständisch und politisch davon befreien. Wenn er sich als gesellschaftliches Wesen betrachtet, so sitzen ihm Vorfahren und Nachkommen (d. h. seine Genealogie) wie die Kobolde auf dem Nacken, sie begleiten ihn wie den Bauer, der sein Haus verbrannt hat in der Meinung sich von ihnen befreien zu können. In geschichtlicher Zeit spielten die durch die politische Standschaft bedingten Gesellschaftsverhältnisse die Hauptrolle und stellten der wissenschaftlichen Genealogie eine Reihe der vornehmsten Aufgaben. Eine ständisch gegliederte Gesellschaft war ohne scharfes genealogisches Bewusstsein nicht denkbar und die Wissenschaft trat ganz in den Dienst der praktischen Interessen; bald in gutem und bald in schlechtem Sinne wurden genealogische Forschungen angestellt und je mehr und sicherer die Abstammung zum Maße aller gesellschaftlichen und politischen Rechte gemacht worden ist, desto entscheidender waren die Ergebnisse des genealogischen Beweises. Kenntnis der Vorfahren, Wissenschaft von der Reihenfolge und Verzweigung der Geschlechter beherrschte vollkommen das gesellschaftliche und politische Leben. Erinnerungen und Nachweise über Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, waren in den meisten und wichtigsten Momenten des Lebens nötig; sie wurden bei der Geburt eines Menschen sorgfältig in Betracht gezogen, sie wurden bei dem Eintritt in ein Standesverhältnis berechnet, sie entschieden über die Satisfaktionsfähigkeit, sie gaben den Ausschlag bei der Eheschließung und bestimmten die Stellung des Mannes wie der Frau nach individueller Bewertung. Die Genealogie repräsentirte in gewissen Zeiten, wenn sie auch nicht die bedeutendste Wissenschaft war, doch das vornehmste Wissen, welches zu vielen Dingen befähigte, die dem Stammbaumlosen verschlossen waren. Und nicht erst in der französischen Revolution haben die unteren Stände den Kampf gegen das genealogische Bewußtsein in der Gesellschaft begonnen. Dem heutigen communistisch gerichteten Classenhaß steht der Bauernkrieg gegen die Ahnentafel und den Stammbaum als durchgreifende Analogie zur Seite. „Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann“ sangen die englischen Landarbeiter im vierzehnten Jahrhundert. Aber sie wußten nicht, daß sie sich gegen einen Begriff erhoben, der zwar in seiner zeitlichen Erscheinung in der menschlichen Gesellschaft (20 ≡)
zur Handhabe des politischen Vorrechts wurde, aber in seinem Wesen und seiner eigentlichen Grundlage eine naturgesetzliche Erkenntnis bedeutet, welcher jedermann unterworfen ist. Der Unterschied zwischen den einen und den andern liegt nicht darin, daß der eine einen Besitz hat, der dem andern mangelt, sondern nur darin, daß der eine eine individuelle Erinnerung und Kenntnis verwertet, welche dem andern abhanden gekommen ist. Das Wesen der Genealogie zeigte sich auch auf dem Standpunkt ihrer praktischen Verwertung darin, daß sie lediglich als individualisirte Wissenschaft Nutzen bringen konnte und daß dem Bauern des vierzehnten Jahrhunderts kein Vortheil daraus entsprang, daß er im allgemeinen voraussetzte, alle Menschen stammten gleichermaßen von Adam und Eva ab. Das individualisirte genealogische Bewußtsein wurde in früheren Zeiten Adel genannt, aber mehr und mehr ist eine Trennung dieser Begriffe vor sich gegangen. Es giebt Adel ohne Stammbaum und Stammbäume ohne Adel. Die Kenntnis der Geschlechterabfolge in Rücksicht auf die persönliche Qualität eines Individuums übt aber ihre Wirkung völlig unabhängig von der Frage, ob in der politisch organisirten Gesellschaft durch dieselbe Stellung, Standschaft, Bevorrechtung, materieller Vortheil erworben worden ist oder nicht. Das ideale Moment des genealogischen Bewußtseins hat eine viel höhere, allgemeinere Bedeutung als das politische. Man kann vielmehr sagen dieses ist jenem untergeordnet, so gut wie das gesammte Dasein des Menschen ein Produkt von Zeugungen bestimmter vorhergegangener Geschlechter war. In der Erkenntnis und in dem Nachweis der individuellen Qualitäten liegt das Geheimnis der genealogischen Wissenschaft. Auch dem Adligen, der seine Ebenbürtigkeit nachzuweisen hatte, konnte es nichts nützen, so und so viele Namen als Vorfahren und Erzeuger zu beschwören, sondern durch die nachgewiesenen Eigenschaften derselben erlangte er erst die durch seine Abstammung ermöglichten gesellschaftlichen Vortheile. Auch das die Standschaft bewirkende genealogische Bewußtsein kann des idealen Moments nicht entbehren, welches bald eine ausgedehntere, bald eine einseitigere Bedeutung haben mochte, stets aber darauf beruhte, daß eine Reihe von Personen durch den Besitz gewisser (21 ≡)
vortheilhafter und die Abwesenheit gewisser nachtheiliger Eigenschaften bekannt und ausgezeichnet gewesen ist. Hierin lag zu allen Zeiten der fruchtbare Kern jedes aristokratischen Prinzips in der Gesellschaft und es ist klar, daß man auf derselben genealogischen Basis jede Art von Aristokratie begründet denken kann: geistige und militärische, priesterliche und handwerkszünftige, landwirtschaftliche und grundbesitzende und in manchen Zeiten und Städten gab es eine Hausbesitzer- und Bierschanksaristokratie. Was die zu erlangenden Eigenschaften allgemeiner Bildung betrifft, so giebt es keine irgenwie erkannte oder erkennbare genealogische Regel, die so einfach wäre, wie die Bestimmungen mancher vormaliger geistlicher Körperschaften über die Bedingungen für eine Domherrnstelle, aber es gibt niemand, der nicht die stille Voraussetzung macht, daß auch in den geistigen Productionen der menschlichen Gesellschaft genealogische Gesetze walten, und daß dem Dichter und dem Gelehrten und Künstler Abstammungsverhältnisse zu gute kommen. Genealogie und Statistik.Daß die Genealogie Beziehungen zu der Statistik gewinnen könne, ist erst in neuester Zeit klarer erkannt worden, und es ist das Verdienst des geistvollen Freiherrn du Prel, auf den Zusammenhang einer ganzen Reihe von merkwürdigen Problemen der Bevölkerungsstatistik mit Fragen, die sich nur aus der Genealogie beantworten lassen werden, zuerst in überzeugender Weise hingewiesen zu haben. In allgemeinerer Entwicklung wurden die Veränderungen in den Bevölkerungsverhältnissen schon früher in einem interessanten Buche von Hansen in Neuburg untersucht und erörtert, wobei sich gezeigt hat, daß in den Abstufungen der Bevölkerung ein Wechsel vor sich geht, der auf das innigste mit genealogisch zu erklärenden Thatsachen zusammenhängt. Statistische Erhebungen, welche Hansen mit größter Sorgfalt im städtischen Gemeinwesen angestellt hat, führten zu dem Ergebnis, daß bei der Annahme von drei Stufen der Bevölkerung eine stetige Ergänzung der oberen Stufen aus den unteren stattfindet und notwendigerweise vor sich (22 ≡)
gehen mußte, wenn diese nicht im Laufe einer gewissen Zeit verloren gehen sollten. Die ganze städtische Bevölkerung zeigt sich als ein Produkt neuerer Zeiten, da der Familienwechsel hier unendlich rasch vor sich geht und der sogenannte Mittelstand lediglich durch Heiraten aus den unteren Ständen sich zu behaupten vermag. Es handelt sich also hierbei um den Nachweis von Geschlechtsveränderungen und um die Erscheinung, daß der Familienbestand der städtischen Bevölkerungen lediglich auf eine gewisse Zahl von Generationen beschränkt ist. Soll nun diese aus Namenverzeichnissen der Bürgerschaften eines Orts zu erschließende und von Hansen erschlossene Thatsache im einzelnen sichergestellt werden, so ist es klar, daß es sich um eine genealogisch durchzuführende Arbeit handelt und du Prel hat mit dem ihm eigenthümlichen Scharfblick auch sofort erkannt, daß man zur völligen Klarstellung der Abwandlungen in den Bevölkerungsverhältnissen durchaus zu dem Studium der Stammbäume wird greifen müssen; ja der gelehrte und energisch thätige Mann hat nicht versäumt, sich sofort an die Untersuchung solcher genealogischer Verhältnisse zu machen, zu denen ihm zahlreiche Ahnenproben ein treffliches Material gaben. Man darf behaupten, daß sich durch diese Betrachtungen ein ganzer Zweig genealogischer Thätigkeit eröffnet hat und es ist zu hoffen, daß eine große Zahl einsichtsvoller Arbeiter auf dem Gebiete der rasch und erstaunlich emporgekommenen statistischen Wissenschaften mehr und mehr zu genealogischen Untersuchungsmethoden fortschreiten werden. Alsbald wird sich auch auf diesem Felde die Erkenntnis aufdrängen, daß die genealogischen Ueberlieferungen viel zahlreicher und inhaltsreicher sind, als man vielfach anzunehmen geneigt schien, und daß der sich auch den Statistiker hier massenhaft darbietende Stoff so gut wie garnicht benutzt zu werden pflegt. Gewisse, der Genealogie verwandte und auf ihren Erfahrungen beruhende Fragen sind ohnehin schon von der Statistik mehr oder weniger zum Gegenstande eigener Untersuchungen gemacht worden. So sollte neuerdings durch Gelehrte dieses Wissenszweiges der von Rümelin[GWR 6] geistvoll, aber wol zu allgemein erörterte Begriff der Generationen auf dem Wege familiärer Einzelforschung zu sicherer Feststellung gebracht werden. Vielleicht wäre ein sorgfältiges (23 ≡)
Studium der nach tausenden zählenden ohnehin vorhandenen Stammbäume aus allen Jahrhunderten ein noch einfacheres Mittel gewesen, zum Ziele zu gelangen. Denn die Generation im Sinne der Bevölkerungsstatistik wird immer nur eine abstrakte Vorstellung und ein formaler Begriff bleiben können, der erst durch die Beobachtung der wirklichen Zeugungsresultate einer Reihe von aufeinanderfolgenden Abstammungen zeitliche Grenzen und eigentlichen Inhalt erlangen kann (s. oben). Will also die Statistik den Begriff der Generation ihrerseits nicht entbehren, so ist sie auch in Folge dieses Zusammenhanges ihrer Aufgabe zur Verwendung genealogischer Ueberlieferungen gezwungen und dürfte sich auf eine ausgebreitete Mitwirkung bei den genealogischen Studien in der Zukunft hingewiesen sehen. Sobald sie sich auf die Erforschung nicht bloß der gegenwärtigen, sondern auch der vergangenen Zustände in ihrer Folgewirkung auf die jeweils nachkommenden Zeiten verlegt, sobald sie mit andern Worten historisch und zeitenvergleichend vorgeht, so kann sie, wie alle Geschichte überdies nicht den genealogischen Standpunkt entbehren, sowenig die Topfkunst von den Töpfern und die Malerei von den Malern abzusehen vermag. Das genealogische Problem ist in Wahrheit auch von der Statistik heute bald von dieser, bald von jener Seite angeschnitten worden, wenn dabei nicht immer systematisch genug verfahren zu werden pflegt, so liegt ohne Zweifel eine Ursache davon darin, daß die genealogische Wissenschaft selbst nicht in sich gefestigt und nicht genug wissenschaftlich erkannt und nutzbar gemacht ist. Indessen giebt der in der statistischen Wissenschaft hervortretende stark historische Gesichtspunkt die Zuversicht einer bedeutenden Unterstützung, die den genealogischen Studien von dieser Seite wird zutheil werden müssen, weil alles, was über Bevölkerungsverhältnisse früherer Zeiten gedacht werden kann, lediglich auf dem Wege der Ahnentafel und der Ahnenprobleme zu erschließen ist und diejenigen, die sich auf diesem Gebiete nicht deutlicher individualisirter Vorstellungen erfreuen, in die größten Irrthümer verfallen müssen. In dem Fortschreiten und im Rückgang der Bevölkerungszahlen, in dem Auf- und Niedergang von Nationalitäten, in der Ausgleichung von Rassenunterschieden stecken wesentlich genealogische (24 ≡)
Probleme. Auf welchem Wege man sich der Lösung derselben zu nähern haben wird, ist eine Frage genealogischer Methode. Die Lehre von den Ahnenverlusten behandelt Gegenstände, deren Tragweite in Bezug auf die Entstehung von Nationen und Volksabstammungen noch gar nicht ermessen werden kann. Das genealogische Verfahren ist vermöge seiner Natur und Wesenheit auf das einzelne so sehr hingewiesen, daß man noch kaum gewagt hat, aus der ungeheuren Masse der bekannt gewordenen Abstammungsverhältnisse einzelner Menschen Schlüsse auf die Entwickelungen zu machen, die sich aus dem Zusammensein der Vielen ergeben. Die Abstammung der Familien, der Völker, der Menschheit wird seit Jahrtausenden in ein sagenhaftes und mythologisches Gewand gehüllt, welches auf genealogische Grundlagen gestellt erscheint, ob aber die wissenschaftliche Genealogie den Weg rückwärts beschreitend zur Entdeckung des Ursprungs der Völker gelangen könne, oder nicht, ist eine wol aufzuwerfende Frage, die vorerst kaum noch angeregt worden ist. In allen diesen Punkten steht unsere heutige genealogische Wissenschaft auf einem jungfräulichen Boden, dessen Bearbeitung die ungeahntesten Resultate erwarten läßt.
Genealogie und Naturwissenschaft.Die modernen Naturwissenschaften haben einen so überwältigenden Einfluß auf die Gedankenwelt gewonnen, daß man berechtigt zu sein glaubt, die meisten Vorstellungen und Ansichten über Sein und Leben auf diese zurückzuführen, wie man die Lösung der sich dabei ergebenden wissenschaftlichen Fragen umgekehrt auch nur von der Naturwissenschaft erwarten zu können meint. Wenn irgendwo von Ahnenforschung, Entwicklungslehre, Vererbung die Rede ist, so wird vorausgesetzt, daß man sich in Gebieten bewege, über welche der Naturforscher ausschließlich zu herrschen im Stande ist. Von gewissen zum Gemeingut gewordenen Begriffen, wie Kampf um das Dasein, wie Vererbung und Anpassung, wird heute in den meisten Wissenschaften Gebrauch gemacht und selbst das Drama und der Roman bemächtigen sich dieser Vorstellungen, um (25 ≡)
Charaktere zu zeichnen, die ohne dieselben kaum mehr ernsthaft genommen, sondern bloß Bedauern oder Heiterkeit erregen könnten. Indem man sich aber den Theorien anzuschließen scheint, von welchen die Naturwissenschaften hauptsächlich getragen sind, erhalten selbst die entferntesten Beziehungen eine gewisse Weihe, deren man sich selbst da zu bemächtigen sucht, wo vielleicht die betreffenden Voraussetzungen nur Verwirrung stiften können. Betrunkene Leute galten der älteren Schauspielkunst fast nur als Motive der Posse, unter den Gesichtspunkten der modernen Biologie und Vererbungslehre sind sie aber sogar zu tragischen Helden geworden. Merkwürdigerweise hat sich die Geschichtswissenschaft verhältnismäßig am wenigsten von den Anschauungen der heutigen Naturforschung beeinflussen lassen. Wo man vielmehr gewisse gemeinsame Gesetze oder Betrachtungsarten aufsuchte, wurde eine starke Gegnerschaft aufgerufen. Und obwol die Geschichte nicht ungern und nicht selten mit dem Entwicklungsbegriff arbeitet, wie die moderne Naturforschung von dem Evolutionsprinzip beherrscht zu werden pflegt, so besteht doch vielfach eine gewisse Gegeneinanderstellung zwischen diesen Wissenschaften, die sich beide vorzugsweise für historisch halten. Während alle ältesten Geschichtserzählungen in Phantasieen von Weltschöpfungen schwelgten, ist die Naturforschung ehemals systematisch und beschreibend zu Werke gegangen, und da diese heute sich ganz geschichtlich und evolutionistisch verhält, hat sich jene immer mehr in sich abgeschlossen und abgesperrt und verabscheut oft den Umgang mit ihrer jüngeren Schwester. Ja es kann vorkommen, daß die leisesten Anklänge an Fragen der natürlichen Entwicklungslehre den Jüngern Klios Sorgen und Aerger bereiten, weil sie meinen, die altehrwürdige Geschichtsmethode wolle sich erniedrigen, bei den Naturwissenschaften in die Schule zu gehen. Wenn der Verfasser dieses Lehrbuchs einmal von Genealogie und Abstammung sprach, so ist es ihm wol begegnet, daß ihm bedeutet wurde, die Geschichte könne sich nicht gefallen lassen, durch Darwin und Genossen belästigt zu werden. So gänzlich hat man zuweilen vergessen, daß die Idee von der Fortpflanzung der Geschlechter, auf welcher alle (26 ≡)
körperliche und geistige wie gesellschaftliche Entwicklung beruht, durchaus als das früheste Eigenthum der Geschichtswissenschaft gelten muß, und daß hierin nicht die Geschichte bei der Naturwissenschaft, sondern jene bei dieser in die Lehre ging. In der That liegt hier ein unzweifelhaft sachlicher Zusammenhang vor, der von der Willkühr, Laune oder dem subjektiven Bedürfnis des Forschers ganz unabhängig ist. Wenn vermöge der Natur der zu erforschenden Sache zwischen der gefundenen historischen Betrachtung und den verschiedensten Zweigen der Naturwissenschaft die mannigfaltigsten Beziehungen sich darbieten, so liegt der Grund davon darin, daß das Objekt der Forschung der Mensch ist, der zwar von verschiedenen Seiten betrachtet werden kann, aber in der Einheit seines Wesens immer derselbe ist. Darin also kann unmöglich etwas auffallendes gesucht werden, weder etwas stolzes noch etwas demütigendes, wenn die auf den Menschen bezüglichen Naturwissenschaftszweige sich bei der Lösung ihrer Probleme ganz nahe mit der Geschichte berühren und die Aufgaben bis zu einem gewissen Grade zusammenfallen. Was die Geschichtsforschung sucht, sind Aufklärungen über menschliche Handlungen, die sich auf die gesellschaftlichen und staatlichen Zustände der Gesammtheit beziehen; was die Naturwissenschaft in Bezug auf den Menschen erstrebt, ist die Erkenntnis seiner Herkunft, Entwicklung, Beschaffenheit und Wesenheit selbst. Der geschichtliche Mensch kann aber doch nicht von dem natürlichen Menschen getrennt werden, und es hat noch keinen Historiker gegeben, der vermocht hätte, bei den von ihm erzählten Handlungen von dem Menschen und der menschlichen Natur abzusehen. Kann und will der Geschichtsforscher sich nicht mit abstracten Schemen, sondern mit dem wirklichen Menschen beschäftigen, sind es Persönlichkeiten, und lebende Wesen, die er darzustellen unternimmt, so bleibt ihm allerdings nichts übrig, als eine Strecke seines Weges den Naturforscher neben sich einherschreiten zu sehen, glücklich, wenn er findet, daß er mit ihm Hand in Hand zu gehen vermag. Die Brücke, auf welcher sich die geschichtliche und Naturforschung begegnen und begegnen müssen, ist die Genealogie. Indem diese die Entwicklungsreihen der menschlichen Zeugungsprodukte ins (27 ≡)
Auge faßt, bestrebt sie sich an dem besondern und einzelnen genau das zu erkennen, was der Forscher auf dem Gebiete des animalischen Lebens überhaupt beobachtet. So nahe berühren sich hier die Ziele dieser Wissenschaften, daß es weitmehr darauf ankommen wird, die Gebiete säuberlich auseinanderzuhalten und von einander zu trennen, als sich für ihre Verbindungen zu bemühen, die sich dem Unbefangenen ohnehin nur zu sehr aufdrängen, denn viel Verwirrung und Unheil kann hier durch Verwechslung der Aufgaben entstehen, die einerseits der auf Grund der Genealogie entwickelten Geschichte und andererseits der den geschichtlichen Hergang des natürlichen Werdens beobachtenden Forschung zugewiesen sind. Ein erheblicher Fehler ist es die Grenzen zu verkennen, die diesen verschiedenen Wissenszweigen sachgemäß gesteckt sind. Der Historiker widerstrebt zuweilen vermöge seiner methodischen Vorstellungen der Naturbeobachtung an sich und der Naturforscher scheint nicht selten zu glauben, daß die Geschichte zur Naturwissenschaft gemacht werden müßte, um völlig exakt und gesichert zu sein. Aber es ist durchaus nicht richtig, daß der Historiker nur von dem Naturforscher empfangen kann, man kann im Gegentheil behaupten, dieser hätte sehr vieles von jenem zu erfahren und zu lernen. Gar vieles, was die Naturforschung mit dem Messer und dem Mikroskop zu gewinnen sucht, bietet die historische Ueberlieferung zwar nicht dem Auge aber dem ahnenden Verständnis. Die Genealogie, historisch erforscht, macht Mittheilungen über Entwicklungsverhältnisse, welche sich den Methoden der Naturfoschung völlig entziehen. Wenn andererseits die Naturforschung an die Geschichte der Erdrinde herantritt, so bereitet sie dem Historiker seinen Boden vor, sie lehrt die Umstände kennen, unter welchen das Leben der Menschen möglich geworden ist. Vom Uebel ist es jedoch, wenn man die Grenze verschiebt, welche diese Wissenschaften von einander scheidet. In einer früheren Epoche der Historiographie glaubte man die geologischen Vorbedingungen des historischen Daseins so wenig für die Erkenntnis der gesellschaftlichen Entwicklungen entbehren zu können, daß der sogenannte weltgeschichtliche oder universalhistorische Standpunkt die Grenze zwischen den geologischen und historischen Ereignissen und Thatsachen (28 ≡)
geradezu aufheben zu müssen glaubte. Unsere Universalhistoriker fielen immer wieder in die Aufgaben zurück, die sich Moses und Hesiod gestellt haben und die der Philosoph seit dem vorigen Jahrhundert heranzog, um den in der Menschheit ruhenden Entwicklungsplan zu erkennen und zu enthüllen; aber alle Bemühungen, die Grenze dieser verschiedenen Wissenszweige zu verschieben oder zu beseitigen, haben nur wenig zur Lösung jener Fragen beitragen können, welche in ihrer Besonderheit der einen und der andern Wissenschaft gestellt sind. Ohne Zweifel kann vom Menschen und seiner fortzeugenden Entwicklung nur die Rede sein im Hinblick auf die feste Erdrinde und unter den Veränderungen derselben wird Leben geweckt und begraben bis auf den heutigen Tag. Alle Handlungen fortschreitender Generationen – der gesammte Gesellschaftszustand – ist, wenn der Vergleich gestattet wird, wie der Leibeigene an die Scholle gebunden, aber der hieraus entstandene Willenszwang erscheint als eine in der geschichtlichen Welt ein für allemal gegebene Größe, die für den historischen Act keine das einzelne erklärende Bedeutung hat und daher auch keiner allgemein erklärenden Einführung bedarf. Der gegebene Naturzustand ist die selbstverständliche Voraussetzung für alles geschichtliche[GWR 7] Menschendasein. Soweit sich die Gebiete berühren, kann die Erkenntnis des einen nicht ohne die des andern bestehen, aber im besondern bleiben sie getrennt und die Naturforschung bedient sich des Begriffs der Geschichte nur in einem übertragenen Sinne, wie die Geschichte der naturwissenschaftlichen Aufklärung gerade so weit bedarf, um die Handlungen des geschichtlichen Menschen aus seiner Erzeugung und Abstammung begreifen und erklären zu können. In dieser Beziehung stellt sich die wissenschaftliche Genealogie in ein besonderes Verhältnis zu den verschiedensten Zweigen der Naturwissenschaft und erhält von denselben sehr verschieden wirkende Belehrungen.
Genealogie und Zoologie.Als sehr auffallend könnte es auf den ersten Blick fast erscheinen, daß gerade zwischen denjenigen beiden Wissenszweigen, die (29 ≡)
scheinbar am verwandtesten sind, weil sie sich beiderseits mit der Fortpflanzung und Entwicklung von geschlechtlich erzeugten Arten von Lebewesen beschäftigen, so gut wie gar keine näheren Beziehungen bestehen. Die Genealogie im Sinne einer historischen Wissenschaft und die moderne Zoologie berühren sich in den Objekten ihrer Forschung genau nur so, wie die Geschichte überhaupt mit der Astronomie und Geologie. Die Zoologie ist da wo der historische – der genealogisch überlieferte Mensch seinen Anfang nimmt, am Ende ihrer Betrachtungen angelangt. Wenn man gleichnisweise sprechen wollte, so dürfte man sagen, der heutige Historiker übernimmt den von ihm beobachteten Menschen als fertiges Individuum aus der Hand des Naturforschers, gleichwie Homer seine Helden aus den Irrfahrten der Götterwelt empfangen hat. Und die Menschenkinder, die Prometheus im Trotz gegen die Götter nach seinem Sinne gebildet hat, sind für die Genealogie im historischen Sinne des Wortes die ersten und einzigen Gegenstände ihrer Forschung, mag der Naturforscher bemerkt haben, daß die Stoffe, aus welchen sie entstanden sind, Steine, Pflanzen oder die Urzelle gewesen sind. Der Genealog mag an die Entwicklungsreihen des modernen Naturforschers seine Beobachtungen über die aufeinanderfolgenden Geschlechter der Menschen anschließen und er wird vielleicht dem Gedanken derselben fortzeugenden Natur ein offenes aufgeklärtes Auge zuwenden, aber die Thatsachen, die sich ihm zur Erforschung und Erklärung aufdrängen, brauchen durchaus nicht mit Notwendigkeit aus einer natürlichen Schöpfungsgeschichte hervorgegangen zu sein, die Nachkommen von Adam und Eva sind völlig individualisiert auf sich gestellte genealogische Objekte, für welche die zwischen Moses und Darwin schwebende Streitfrage durchaus sekundärer Natur ist. Es ist daher ein volles Mißverständnis, wenn Leute, die sich in den allerengsten Kreisen bewegen, nicht ohne gewisse Geringschätzung gegen Wissenschaften, deren Größe und geistige Bedeutung ihnen unbekannt ist, die Meinung hegen, daß eine geregelte Betrachtung der Geschlechterentwicklung der historischen Menschheit eine Frucht oder eine Folge der heutigen naturwissenschaftlichen Doctrin sei, man sollte in Wahrheit das umgekehrte behaupten: die Methode (30 ≡)
der Naturwissenschaft ist in diesen Zweigen historisch geworden und hat der uralten historischen Genealogie das Handwerk abgelernt. Sie ist es, welche die Ahnenforschung aus der Geschichte der Menschen entlehnt und zu einer Entwicklungslehre des lebenden Organismus überhaupt erhoben hat. Es ist eine wol aufzuwerfende Frage, ob nicht durch eine genauere Beobachtung genealogisch-historisch festzustellender Thatsachen der menschheitlichen Geschichte, welche vielfach sicherere Quellen darbietet, als diejenige des Thieres, auch für die ursprünglichen Stufen der Entwicklung bedeutendere Gesichtspunkte zu gewinnen wären. Wenn der Thierzüchter seine genealogischen Beobachtungen mit Geschick und Fleiß feststellt, so hat er sich Methoden und Gesichtspunkte angeeignet, die durch redende Zeugen und geschriebene Zeugnisse dem Menschengeschlechte längst etwas vertrautes waren, aber es ist umgekehrt ebenso richtig, daß die genealogische Wissenschaft aus der unbewußten Zeugungs- und Vererbungsthatsache, welche die Zoologie kennt, auch ihrerseits Schlüsse ziehen kann. Eine solche Fülle von Wechselbeziehungen eröffnet sich auch da, wo an eine Wechselwirkung noch gar nicht gedacht zu werden braucht, daß wol nichts befruchtender sein kann, als die gleiche Beachtung so nahe verwandter Nachbargebiete. Wie die thierische und menschliche Welt nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich unendliche Analogieen darbietet, so ergänzen sich auch die Gesichtspunkte der genealogischen Forschung wo immer man den Thatsachen der Zeugung und Abstammung nachgeht. Sicherlich wird sowol das eine wie das andere Gebiet Nutzen ziehen können aus der wechselseitigen Beobachtung der Methode und ihrer Ergebnisse. Die Entwicklungslehre der Arten kann aus der Genealogie nicht nur die Mannigfaltigkeit der Zeugungsergebnisse bei gleicher Herkunft, sondern auch die eingreifenden Veränderungen der durch die Ahnenverzweigung bestimmten Abstammung entnehmen, und diese wird aus jener die Bedingungen und Wirkungen des Anpassungsgesetzes der Generationen weit sicherer und zuverlässiger erfahren, als aus den geschichtlich erwiesenen Umständen, die den Menschen kaum einer wesentlichen Veränderung unterworfen erscheinen lassen. Selbst in den formalen Fragen und Darstellungen würde ein genaueres (31 ≡)
Studium der Genealogie für die Entwicklungslehre nicht unzweckgemäß sein. So spricht man in der Regel von philogenetischen Stammbäumen, während man eigentlich Ahnentafeln im Auge hat, bei welcher formalen Verwechselung dann aber ein sachlicher Irrthum darin unterläuft, daß man bei einer solchen Ahnentafel von den Geschlechtsunterschieden absehen zu können meint und nur die männlichen Abstammungsverhältnisse berücksichtigt. So kommt es denn, daß die Ahnentafeln, die von der Descendenztheorie aufgestellt worden sind, von Kreuzungs- und Mischungsverhältnissen ganz abzusehen scheinen, während das auf die Entstehung der Arten bezügliche Experiment eigentlich nur von der Kreuzung der Rassen seinen Ursprung nahm. Der Hinweis auf die von der Genealogie untersuchte Ahnentafel mit ihrer strengen, beide Geschlechter gleich berücksichtigenden Gliederung ist vielleicht hier recht am Platze. Die Forschungen im Gebiete der menschlichen Ahnentafel sind von ganz besonderer Fruchtbarkeit für alle naturwissenschaftlichen Fragen, weil sie eine ungeahnte Menge von Fällen in Betracht ziehen und immerhin über ein wol überliefertes Material verfügen, welchem kein anderes vergleichbar sein dürfte. Wenn also auch der von der Genealogie ins Auge gefaßte Mensch keinerlei Auskunft über seine Abstammung im Sinne der heutigen Descendenztheorie zu geben vermag, die beide hier in Betracht kommenden Wissenschaften vielmehr stets als etwas völlig getrenntes erscheinen werden, so mangelt es doch keineswegs an gewissen analogen Vorgängen, welche zwischen der Ahnentafel des einzelnen Individuums und zwischen derjenigen des Menschen überhaupt bestehn. Und außerdem ergeben sich für die Naturforschung aus der Betrachtung der Ahnentafel jedes einzelnen Individuums gewisse Probleme, deren Lösung vielleicht kaum noch in Betracht gezogen ist. Denn wenn die Ahnenforschung des Menschen zu einer unendlichen Vielheit von Individuen führt, so kann der Descendenzlehre umgekehrt die Frage nicht erspart bleiben, wie der Uebergang der Arten von einer Form zur andern gedacht werden kann, wenn die Genealogie doch lehrt, daß jedes Individuum eine unendliche Menge von gleichartigen und gleichzeitig zeugenden Ahnen voraussetzt und die Vorstellung einer Abstammung des Menschen durch Zeugungen Eines (32 ≡)
Paares an der unzweifelhaft feststehenden Thatsache scheitern muß, daß jedes einzelne Dasein vielmehr eine unendliche Zahl von Adams und Evas zur Bedingung hat. Die Einheitlichkeit des Abstammungsprinzips steht daher zunächst im vollen Widerspruch zu den genealogischen Beobachtungen.
Genealogie, Physiologie, Psychologie.In einer anderen und viel innigeren Beziehung steht die Genealogie noch zu jenen Naturwissenschaften, die sich mit dem Menschen als solchem in seiner Natur und Wesenheit beschäftigen. Es ist klar, daß der seiner genealogischen Verhältnisse sich bewußte Mensch, indem er handelnd und geschichtlich erscheint, sich in der Einheit seines Seins nur als Ganzes begreifen läßt und daher zu seiner Selbsterkenntnis der physiologischen wie der psychologischen Beobachtung gleichermaßen bedarf. Es wäre überflüssig an dieser Stelle die Fragen zu berühren, die sich auf den Zusammenhang der auf Seele und Leib, wie man sonst zu sagen pflegte, bezüglichen Erfahrungen und Wissenschaften beziehen. Für die Genealogie treten die Differenzen, die sich etwa in den Anschauungen über diese Dinge ergeben könnten, gänzlich in den Hintergrund. Das menschliche Zeugungsprodukt erscheint in der Geschichte ohne weiteres mit gleichwertigen Antheilen von Seelen- und Leibesthätigkeiten, und wenn man in historisirender Abstraktion vom Geist spricht, der in der Geschichte waltet, so versteht dies doch niemand anders, als daß dieser nur vermöge der genealogisch verstandenen körperlichen Wesen wirksam sein kann. Der Todte macht keine Geschichte. Auch jene, welche sich die Geistgeschichte in den mannigfachsten Formen thätig denken, als eine philosophische ideale Gesetzeswelt, als weltgöttliche Emanation, oder als gutchristliche Erdenwanderung aufsteigender Engel oder absteigender Teufel, können doch nicht davon absehen, daß alles, was von Menschen geschehen ist, von Wesen herkam, welche geboren wurden und starben. Auch denen, die in den modernen Betrieb der Geschichte so außerordentlich „gesetzeslüstern“ geworden sind, daß sie ohne Aufstellung von allerlei historischen Gesetzen gar nicht mehr ein Geschichtsbuch lesen (33 ≡)
mögen, kann man nicht genug die Gesetze des Geborenwerdens und Sterbens empfehlen, da diese doch die einzigen sind, auf deren immer erneute Wirksamkeit der Historiker mit voller Sicherheit rechnen kann, wobei er sich jedoch nicht zu verhehlen braucht, daß die allgemeine Beobachtung auch dieser Gesetze nichts anderes als die Anerkennung einer trivialen Thatsache ist. Indem sich aber die genealogische Wissenschaft auf den Standpunkt der Beobachtung des durch Geburt und Tod in seiner Wirksamkeit begrenzten Individuums stellt, fallen ihre Aufgaben zum großen Theil mit den Untersuchungen jener Wissenschaften zusammen, die den Menschen in seinen leiblichen und geistigen Eigenschaften überhaupt zum Objekt haben. Die Genealogie kann aber den biologischen Fragen überhaupt zu Hilfe kommen, indem sie sich, soweit ihr die Quellen zu Gebote stehen, zugleich auf jene Erinnerungen und Erfahrungen stützt, die von früheren Individuen auf spätere, also von den Voreltern auf die Nachkommen übergegangen sind. In Folge der Beobachtung des Zusammenhanges der aufeinander folgenden Geschlechter construirt sich in der Genealogie ganz von selbst der Begriff der Vererbung der Eigenschaften durch Erzeugung immer neuer Geschlechtsreihen, deren Wesen und Sein ohne die Erkenntnis ihrer Eigenschaften und Verwandlungen nicht verstanden werden könnte. Der Genealog bietet daher dem Biologen eine Thatsachenreihe dar, die sich auf keinem andern Wege, als auf dem der bewußten Ueberlieferung der Geschlechter erreichen läßt. Wollte man die Beobachtung vererbter Eigenschaften lediglich auf die Vergleichung lebender Wesen begründen, so würde dieser wissenschaftliche Begriff im äußersten Maße beschränkt erscheinen. Es könnte dann im besten Falle nur der Beweis geliefert werden, daß gewisse Eigenschaften erwachsener Menschen auch bei deren Großeltern vorkommen. Wollte man aber sich damit nicht genügen lassen, sondern die Vererbungsfrage auch weiter hinaufsteigenden Generationen gegenüber zur Entscheidung bringen, so befände man sich im Gebiete genealogischer Ueberlieferungen und vermöchte diese nicht einen Augenblick zu entbehren. In Folge dessen läßt sich behaupten, daß jede physiologische und psychologische Untersuchung, die sich auf die Vererbung der Eigenschaften bezieht, genealogisch ist. (34 ≡)
Durch die sichergestellte Kenntnis schon der äußeren Eigenschaften vorhergegangener Geschlechter gelangt man zu dem Schluße, daß der Mensch, den die Wissenschaft heute untersucht, derselbe ist, den Aristoteles gekannt hat, und daß folglich im Wege der Zeugung und Abstammung keine Eigenschaftsveränderung stattgefunden hat. Bildnisse, die vor tausenden von Jahren gemacht worden sind, zeigen, daß die Menschen immer zwei Augen und zwei Ohren und eine Nase von einer Generation auf die andere übertragen haben. In dieser Allgemeinheit ist die Erblichkeit als durchgehendes Prinzip alles organischen Lebens überhaupt ein Axiom, zu dessen Erkenntnis es kaum eines besonderen Beweises bedarf. Die Theorie, welche sich mit der Erklärung dieser Erscheinung des organischen Lebens beschäftigte, bedurfte thatsächlich von Darwin bis Weismann keines besonderen genealogischen Studiums und es wäre lächerlich gewesen zu verlangen, daß die Abstammungsreihen der heutigen Menschen wirklich nachgewiesen sein müßten, um zur Erklärung von Vorgängen der Natur zu schreiten, welche die stetige Wiederholung der gleichartigen Eigenschaften der von einander abstammenden Individuen zur Folge hatten. Die Beobachtungen, welche an den heutigen Eltern und Kindern gemacht sind, dürfen als Voraussetzung einer unendlichen Reihe von gleichzeitigen und in der Zeit vorangehenden Fällen zur Grundlage jeder Vererbungstheorie mit Recht gemacht werden, und es bedarf keiner historisch-genealogischen Untersuchung darüber, ob alle unsere Ahnentafeln auf Adam und Eva zurückgehen oder nicht. Wenn es der Naturforschung gelungen ist, den Vorgang bei der Entwicklung der Arten in einem Falle zu erklären, so ist es klar, daß auch jene Vererbungen und Veränderungen damit erklärlich sind, die bei allen früheren Generationen stattgefunden haben. Die genealogische Wissenschaft braucht sich hier keineswegs einem Forschungsgebiete aufzudrängen, welches in der Umsicht seiner Methoden durchaus auf sich selbst gestellt ist und bleiben wird. Und auch die Psychologie, die sich seit Sokrates auf ein und dasselbe Beobachtungsprinzip stützt und in der „Selbsterkenntnis“ den ganzen Umfang ihres Gebietes richtig bezeichnet weiß, bedarf zur Untersuchung der geistigen Lebensvorgänge keineswegs einen (35 ≡)
Hinweis auf vergangene Geschlechter und noch niemand hat daran gezweifelt, daß für alle menschlichen Wesen dieselben Denkgesetze galten. Auch hier könnte man daher mit Recht ein eigentliches genealogisches Studium für höchst überflüssig halten, wenn es auch schon sicher ist, daß sich die Psychologie zu allen Zeiten doch genötigt sah ihr Beobachtungsmaterial möglichst zu verbreitern und sich nicht mit den Thatsachen eines Lebens zu begnügen, sondern so mannigfaltig wie möglich in die Erfahrungen vieler Geschlechter und vergangener Zeiten zurückzugreifen. Danach aber ist gerade von Psychologen die Forderung in neuerer Zeit gestellt worden, daß die Forschung auf eine gewisse genealogische Basis gestellt werden könnte, um auch hier den Erblichkeitsbegriff besser erfassen zu können, und andererseits ist auch neben dem psychologischen Bedürfnis der Ahnenkenntnis vermöge der pathologischen Vorgänge im Organismus auch die physiologische Betrachtung mehr und mehr dem Stammbaum zugewendet worden. So lange es sich mit einem Worte um den allgemeinen Bestand physiologischer und psychologischer Eigenschaften handelt bedarf weder diese noch jene Wissenschaft eines Hinblicks auf genealogisch-historische Thatsachen. Die letzteren können erst von Bedeutung werden, wenn es sich um Veränderungen handelt, die in dem Organismus des Individuums zu beobachten sind. Vom Standpunkt der Erblichkeit betrachtet darf man also sagen, daß sich das genealogische Moment erst da der Forschung aufdrängt, wo es sich hauptsächlich um die Veränderung handelt. Wie in der Natur die Vererbung ohne die Veränderung nicht gedacht werden kann, weil sich trotz aller Gleichartigkeit der Individuen doch nicht zwei völlig gleiche finden, so kann der Begriff der Vererbung der Eigenschaften wissenschaftlich nicht ohne den der Variabilität gedacht werden. Diese aber ist historischer Natur, ein werdendes, welches sich dem gewesenen entgegensetzt. Hier ist der Punkt wo das genealogische Moment sich jeder Art von biologischer Forschung unbedingt und ohne unser Zuthun nicht nur empfiehlt, sondern aufdrängt. Wäre aller natürlich fortgepflanzte Organismus ausschließlich (36 ≡)
auf die Erblichkeit gestellt, so hätten auch die höchstentwickelten Wesen keine Geschichte. Wie die verschiedenen Arten der Steine immer in derselben Weise krystallisiren, so würde die vollendete Vererbung der Eigenschaften der organischen Wesen eine Gleichartigkeit zur Folge haben, die selbst eine Verschiedenheit der Thätigkeit des Individuums ausschlösse; indem aber in leiblicher und geistiger Beziehung die Variabilitäten desto größer werden, je entwickelter der Organismus des Individuums ist, so sind auch die Lebensäußerungen derselben einem Wechsel unterworfen, der geschichtliche Entwicklung bedeutet. Alle Geschichte hat Veränderungen in den Eigenschaften der Menschen zur Voraussetzung und die Beobachtung derselben kann nur auf dem Wege genealogischer Forschung geschehen. Die wechselnden Generationen sind ein Produkt der immer gleiches anstrebenden Vererbung und der stets neues zeugenden Varietät. Die Vererbung bewirkt den Begriff der Art und Gattung, die Veränderlichkeit den Begriff der Geschichte. In dem genealogischen Fortgang findet die Wissenschaft von dem einen und dem andern ihr Maß und Ziel.
Genealogie und Psychiatrie.Da, wo die Veränderungen am Organismus einen pathologischen Character angenommen[GWR 8] haben, ist es demnach sehr erklärlich, daß die Ursachenforschung den Hinblick auf die Genealogie am allerwenigsten entbehren kann. So ist aus der rückwärts gestellten Beobachtung physischer und psychischer Erkrankungen die Frage der Erblichkeit zu einem genealogischen Hauptproblem der Psychiatrie geworden, in Folge dessen die pathologische Ahnenforschung seit geraumer Zeit einen hervorragenden Zweig ihrer Beobachtungen bildet. Hier berühren sich die Arbeitsgebiete so unendlich nahe, daß es überflüssig erscheint, viel darüber zu bemerken. Es bedarf lediglich einer Betrachtung über die Art und Weise, wie sich die Genealogie für die psychiatrische Wissenschaft am zweckmäßigsten verwenden lassen wird, da über die prinzipielle Seite des Verhältnisses (37 ≡)
kaum ein leisester Zweifel vorhanden ist. Der Stammbaum ist im Gebiete der psychiatrischen Theorie und Praxis ein Gegenstand der ausgiebigsten Untersuchungen, aber dennoch wird man gerade nicht behaupten, daß diese nach ihren Ausgangspunkten so gänzlich verschiedenen Wissenschaften sich gegenseitig heute schon sehr stark unterstützt hätten. Man darf vielmehr den Wunsch aussprechen, daß der praktische Nutzen, der hier augenscheinlich aus dem Studium der Genealogie entspringen kann, dazu führen möchte, derselben mehr Freunde und größere Verbreitung gerade im Kreise dieser Forscher zu verschaffen. Für die wissenschaftlichen Fragen, welche sich vom Standpunkte physiologischer wie psychologischer und pathologischer Forschung ergeben, wird es ohne Zweifel von unabsehbarem Vortheile sein, wenn einstens die genealogischen Arbeiten in solcher Vollkommenheit vorliegen werden, daß die Vererbungs- und Veränderungsmomente in den Zeugungen einer langen Reihe von Generationen genau festgestellt werden können. Dazu liegt geschichtlich schon jetzt ein sehr großes Material vor, welches lediglich der Ordnung und Bearbeitung bedarf. Andererseits ist zur Aufstellung genealogischer Tafeln in aufsteigender oder absteigender Linie eine gewisse methodische Uebung nötig, durch welche wol mancherlei Fehler des psychologischen und pathologischen Calcüls vermieden werden dürften. Sammlung genealogischer Daten ist zwar unter allen Umständen höchst erwünscht, wenn dieselben aber nicht mit Anwendung strengster historischer Kritik zu Stande gekommen sind, so lassen sich sichere Schlüsse wol schwerlich an dieselben knüpfen. Die Nachfrage persönlicher Art nach den Qualitäten vorangegangener oder überhaupt verwandter Personen läßt dem subjektiven Ermessen und vielleicht dem Urtheil wenig urtheilsfähiger Leute einen zu großen Spielraum. Eine Hilfe mag dem Praktiker auch diese dilettantische Art der Stammbaumforschung darbieten; für eine gesicherte Theorie dagegen können gewiß nur jene ein für allemal historisch erforschten Zeugungs- und Abstammungsverhältnisse etwas darbieten, bei denen in einer unendlichen Menge von blutsverwandtschaftlichen Beziehungen das ganze Material von Vererbungs- und Varietätsfällen ohne irgend eine Voraussetzung festgelegt worden ist. Die (38 ≡)
Erweiterung unserer genealogischen Quellen ist daher eine Hauptaufgabe, an deren Lösung gerade jene Wissenschaften das größte Interesse nehmen sollten, die auf die Untersuchung von Erblichkeitsfragen seit geraumer Zeit schon ein großes Gewicht zu legen pflegen.
Die Genealogie und der historische Fortschritt.Der Vererbung individueller Eigenschaften durch Zeugung und Abstammung steht die Veränderung derselben gegenüber und die Genealogie beschäftigt sich mit der Feststellung der im einzelnen überlieferten diesbezüglichen Thatsachen ohne zunächst den Anspruch erheben zu können eine Erklärung für dieselben zu geben. Sie überläßt es vielmehr den verwandten naturwissenschaftlichen Zweigen die Aufgabe zu lösen, die sich aus der nachgewiesenen Vererbung und Variabilität der Eigenschaften ergeben werden. Indem aber die Genealogie ein umfassendes Material der Beobachtung darbietet, kann sie sich ihrerseits nur auf den Standpunkt des Schülers gegenüber der naturwissenschaftlichen und psychologischen Untersuchung und Theorie stellen. Sie darf sich nicht in Widerspruch gegen dieselben setzen und finden lassen, darf aber allerdings die Hoffnung hegen, jenen wissenschaftlichen Zweigen dadurch eine vielleicht unerwartete Unterstützung gewähren zu können, daß sie die Erblichkeits- und Veränderungsverhältnisse im Gegensatze zu einer bloßen Statistik gegenwärtiger Zustände durch viele Generationen rückwärts zu verfolgen und vermöge ihrer genauen Kenntnis der einzelnen Zeugungsergebnisse durch sehr lange Reihen von Geschlechtsfolgen in einer unendlichen Anzahl von überlieferten Fällen das Problem der Erblichkeit in exakter empirischer Weise zu behandeln vermag. Indem sie sich aber auf der Grundlage der Prüfung der einzelnen Fälle zu einer Betrachtung der in immer neuen Reihen sich bildenden Generationen und ihrer Wirksamkeit erhebt, nähert sie sich der Beantwortung einer Frage, die von sehr entgegengesetzten Standpunkten, einerseits von der biologischen Naturforschung, andererseits von den geschichtlichen Wissenschaften her angeregt zu werden pflegt. Alle Entwicklungslehre, wie sie einerseits von der Naturforschung, (39 ≡)
andererseits von vielen historischen Denkern mehr oder weniger hypothetisch gefaßt zu werden pflegt, gipfelt in dem Begriff des Fortschritts oder der Vervollkommnung, die man einerseits in den vom Individuum ausgehenden Lebensäußerungen objektiv, andererseits aber auch auf Grund der Eigenschaftsveränderungen desselben in subjektivem Sinne verstanden wissen will. Hiebei nimmt die natürliche Entwicklungslehre der neuesten Zeit im ganzen einen vorsichtigeren Standpunkt ein, als die viel älteren Wissenszweige, welche bald auf historischen, bald auf philosophischen Wegen das Fortschrittsproblem erörterten. Denn die natürliche Entwicklungslehre wie sie insbesondere von Darwin vermöge der besonnenen Bescheidenheit des großen Forschers verstanden worden ist, beschränkt sich durchaus darauf den Begriff und die Entstehung der Arten unter das Entwicklungsgesetz zu stellen, verzichtet aber wol darauf innerhalb der erkannten Stufen aus etwaigen Eigenschaftsveränderungen einzelner Individualitäten auf ein allgemeines Fortschrittsgesetz zu schließen. Und wenn auch in übel verstandener Anwendung der Darwinschen Theorie zuweilen die Schlußfolgerung gezogen worden ist, daß die genealogisch sich entwickelnden Geschlechtsreihen, analog den nachgewiesenen Stammtafeln der niederen organischen Wesen in stetiger innerer Vervollkommnung der Individuen ebenfalls eine aufsteigende Linie des Fortschritts bildeten, so dürfte man doch durchaus nicht behaupten, daß die exakte Naturforschung zu solchen Uebereilungen Anlaß gegeben hätte. Die letztere weiß vielmehr ganz genau, daß ihre auf die Entstehung der Arten bezüglichen thatsächlichen Nachweisungen alle nur unter der Annahme von Zeiträumen denkbar sind, denen gegenüber die kleine Spanne von Jahrhunderten, in welche unsere historisch-genealogischen Beobachtungen des Menschendaseins fallen, als eine minimalste Größe gar nicht in Betracht kommen wird. Zu einer Verwendbarkeit von Entwicklungsgesetzen der Schöpfungsgeschichte – wenn es erlaubt ist diesen Ausdruck zu gebrauchen – für die geringfügigen Variabilitäten der historisch überlieferten Zeiträume, in welche menschliches Dasein fällt, wird sich kaum jemand ernsthaft bekennen wollen, wenn auch, man könnte sagen, eine gewisse Art religiösen Dranges den Wunsch rege machen mag, daß die allgemeinen Gesetze der (40 ≡)
Entwicklung eine erfreuliche Analogie auch in den kleinsten Zeiträumen gewissermaßen unsichtbar anzunehmen gestatteten. Zu etwas sicherem aber vermochten Schädelmessungen in historischen Zeiten wol nicht zu führen und wie es scheint, würden selbst nachweisbare Variabilitäten bei ausgegrabenen anatomischen Resten menschlichen Daseins gegenüber der historisch erkennbaren psychischen Größe vergangener Geschlechter – denke man dabei an Semiten oder Japhetiden, an Chinesen, Inder oder Griechen – sich stets hinfällig erweisen müssen. Würde sich aber auch die Naturforschung des Problems in dem Sinne bemächtigen, daß sie den Entwicklungsprozeß an dem historischen Menschen nachzuweisen unternähme, so würde dies am allerwenigsten ohne genaue genealogische Untersuchungen möglich sein, von denen es freilich zweifelhaft wäre, ob das nötige genealogische Material hiefür aus den menschheitlichen Erinnerungen selbst fließen dürfte. Denn wollte man die natürlichen Ursachen der Artenverbesserungen bei dem historischen Menschen exakt zur Darstellung bringen, so würde ohne Zweifel das Studium der Rassen-, Völker- und Familienkreuzungen in die erste Linie zu stellen sein. Alsdann müßte eine Wissenschaft geschaffen werden, die, indem sie auf die Untersuchung der einzelnen Fälle begründet werden müßte, nicht nur eine Ergänzung, sondern geradezu einen Gipfelpunkt aller genealogischen Forschung zu bedeuten hätte. Die Genealogie würde in Folge dessen eine Aufgabe zu bewältigen haben, die erst nach Ablauf einer ganzen Reihe von Generationen, für welche quellenmäßige Nachrichten zu sammeln wären, zu Ergebnissen gelangen könnte. Denn so sehr auch Rassen- und Völkermischungen seit tausenden von Jahren als eine im allgemeinen feststehende Thatsache bekannt sind, so wenig sind dieselben genealogisch genau untersucht, und so lange sie nicht genealogisch genau bekannt sind, werden alle anthropologischen Betrachtungen über eine gewisse Grenze der Beobachtung von einer oder zwei Generationen hinaus zu keiner Sicherheit gelangen können. Selbst die Kreuzungsverhältnisse zwischen schwarzen und weißen Rassen sind heute noch in Dunkel gehüllt, und selbst die auffallendsten physiologischen Merkmale der Vererbung sind durch eine genügende genealogische Quellenforschung nicht gesichert, sondern meist nur auf (41 ≡)
ein anekdotenhaftes Material gestützt. Die anthropologische, biologische und physiologische Forschung über Vererbung und Veränderung der menschlichen Eigenschaften bedürfte eines umfassenden genealogischen Studiums, wenn ihre Resultate gesichert werden sollten. Möchte die Einsicht in das so deutlich vorhandene Bedürfnis bei dem Entgegenkommen, dessen sich alle Naturwissenschaften heute erfreuen, dazu führen, daß man sich zur Errichtung großer genealogischer Forschungsanstalten entschlösse, die doch sicherlich ebenso viel oder noch mehr Berechtigung haben würden, als diejenigen Beobachtungsstationen, die man den niederen Organismen in so großartigem Maßstabe allerorten zu theil werden läßt! Jedenfalls würde auf diesem Wege einzig und allein das Problem des Fortschritts, beziehungsweise der Vervollkommnung der innerhalb der historischen Zeit lebenden Individualitäten, sowie der sich nach abwärts entwickelnden Generationen der Stammbäume der nächsten Jahrhunderte exakt und nach Analogie sonst gebräuchlicher naturwissenschaftlicher Methoden gelöst werden können. Andere Wege und Methoden sind dagegen von philosophischen und historischen Denkern seit den ältesten Zeiten eingeschlagen worden, um dem stets vorhandenen Fortschrittsglauben der Menschheit eine feste Grundlage zu verschaffen und man kann allerdings nicht läugnen, daß nach der Auffassung der meisten geltenden Fortschrittstheorien die Genealogie als solche für die Lösung des Problems überflüssig wäre. Die Philosophie der Geschichte beansprucht seit den Zeiten des Augustin und Eusebius eine gleichsam in sich selbst ruhende Gewißheit und Anerkennung dieses Glaubens, und so verschieden die Formen sind, in welchen der Fortschritt nach der Meinung der verschiedensten Philosophen zur Erscheinung kommt, so bestimmt wird doch dieser selbst als eine petitio principii ohne weiteres vorausgesetzt und so sehr beeinflußt er die allermeisten historischen Darstellungen der bedeutendsten neueren Völker. So ganz hat diese Vorstellungsweise vermöge der Befriedigung, die sie dem menschlichen Gemüte gibt, etwas dogmatisches angenommen, daß man die genealogischen Schwierigkeiten, die sie bietet, von Seiten der meisten Historiker und Philosophen ganz und gar (42 ≡)
unbeachtet ließ. In einem der vielen neueren Bücher über Philosophie der Geschichte, worin die Versuche dieser Art trefflich seit ältester Zeit dargelegt sind, in dem Werke von Rocholl, kann man beispielsweise die Wahrnehmung machen, daß alle Versuche, die Möglichkeit einer Philosophie der Geschichte zu läugnen, von vornherein mit der Bemerkung zurückgewiesen werden, daß diese überhaupt eine solche Negation nicht zu beantworten brauchte. Schopenhauer und Goethe müßten freilich von diesem Standpunkte aus für Thoren betrachtet werden. Dagegen dürfte man das Verdienst Rocholls darin nicht für gering anschlagen, daß er mit einer vielen anderen geschichtsphilosophischen Arbeiten fehlenden Aufrichtigkeit dem Fortschrittsproblem in der Geschichte seinen rein dogmatischen Charakter wahrt. Alle Versuche zu einer Philosophie der Geschichte zu gelangen, beruhen auf der Vorstellung eines Zweckes oder Zieles, das auf dem Wege ihrer Geschichte von der Menschheit erreicht werden müsse. Die alten christlichen Philosophen waren unbefangen und weise genug, die Erfüllung des Lebenszweckes in eine andere Welt zu versetzen. Sie redeten zu nüchternen Menschen, die sich nicht weiß machen ließen, daß die auf dieser Welt sich vollziehende Geschichte irgend eine wesentliche Veränderung in irgend einem Stücke erkennen ließe. Indem jedes individuelle Leben eine auf sich selbst gestellte unendliche, ewige, unsterbliche Entwicklungsreihe besitzen sollte, war es für die Auffassung des Geschichtsphilosophen von Augustin bis Otto von Freising etwas ganz nebensächliches, ob man sich die erwartete Vollendung diesseits oder jenseits vorstellte. Die Hauptsache war, daß der Lebenszweck, das Ziel erreicht wurde. Später hat man die Sache gleichsam umgedreht; da die Leute unchristlich und ungläubig geworden sind, und auf die Geschichtsvollendung im Himmel nicht warten wollten, so erfanden sie sich eine irdische Geschichtsphilosophie und ein diesseits anzustrebendes Paradies, und suchten sich einzubilden, man rücke zusehends von Jahrhundert zu Jahrhundert auf dem Wege der Geschichte in den himmlischen Zustand hinein. Dabei ging allerdings das individuelle Moment verloren und die Vervollkommnung, welche (43 ≡)
die christliche Philosophie jedem einzelnen versprach, wurde mehr und mehr zu einem abstracten Zustandsbegriff der Menschheit überhaupt. Die ganze Vorstellungsart, ganz gleichgiltig, ob sie auf dem Wege philosophischer und ethischer, kulturhistorischer oder wiedertäuferischer und sozialistischer Combinationen und Lehren entstanden ist, war und blieb ein dogmatischer Ueberrest, ein materialistisch geformter religiöser Altruismus, weil dem philosophirenden Geschlecht die lebhafte Phantasie der alten christlichen Philosophen, vielleicht der alten Welt überhaupt fehlte, die Zweckbestimmung der geschichtlichen Entwicklung in das Jenseits mit seinen Heiligen und Engeln zu verlegen. Fragt man aber nach der größern Vernünftigkeit dieser ganz verwandten, aber in Betreff der Form des zu erreichenden Zustandes sich völlig ausschließenden Anschauungen, so scheint kein Zweifel zu sein, daß diejenige Ottos von Freising oder Dantes, abgesehen von ihrer poetischen Natur und Verwendbarkeit, jedenfalls um vieles einleuchtender und glaubwürdiger war. Denn daß die Seelen nach dem Tode zur Vollendung und Reinigung kommen werden, vermochte Dante zu versichern, ohne daß es irgend jemand gelingen konnte einen Gegenbeweis zu liefern, während in Betreff des diesseitigen Lebens, der thatsächlichen geschichtlichen Entwicklung jeder Tag einem jeden Menschen den Beweis liefert, wie Geburt und Tod und jede innerhalb dieser Grenzen eintretende individuelle Hinfälligkeit und Elendigkeit ohne die allergeringste Vervollkommnung des Menschen und ohne jede Veränderung seiner Schmerzen in unverändertem Einerlei wechseln. Der Philosoph, welcher der Geschichte einen erkennbaren zu einem Ziele hinstrebenden Plan unterlegt, mag er an Utopia, oder mit den Modernen an Cabets Ikarien denken, lebt also in einer Welt von Phantasie, die ihren Himmel diesseits aufbaut. Immer werden diese Anschauungen und Lehren, welcher Art und Schule sie auch sein mögen, genötigt sein von zwei Dingen abzusehen, von der Zeit und von dem Einzelleben, welches auf Zeugung und Abstammung von einer gleichen Art und gleichen Wesen unabänderlich beruht. So hat diese Art der historischen Abstractionen hauptsächlich dem genealogischen Studium Abbruch gethan, sie hat am meisten die Genealogie geschädigt und gestürzt. Und indem sie sich (44 ≡)
des Kunstgriffs bediente vom Zeitbegriff sich ganz zu trennen, tritt die Unwahrheit ihres Systems zu Tage, denn eine Geschichte ohne Zeitmaß ist ein Roman. Nicht alle aber waren so ehrlich wie Thomas Morus, ihre utopistische Philosophie als einen bloßen Roman zu erklären. Die meisten halfen sich mit dem rein formalen Begriff des Fortschritts, welcher über den von der Geschichte unerbittlich geforderten Maßstab der Zeit glücklich hinwegtäuschen konnte. Der Begriff des Fortschritts, als oberstes Prinzip der geschichtlichen Entwicklung, ist vermöge seiner unendlichen Bequemlichkeit eigentlich als der Bodensatz aller geschichtsphilosophischen Betrachtungen und Erörterungen anzusehen und zu erkennen. An diese Fortschrittsidee, die dem politischen und dem culturhistorischen Doctrinär gleich willkommen ist, hat sich in heutiger Zeit eine Art Religion gehängt, die dann alle, die sich mit geschichtlichen Dingen beschäftigen, jedes weiteren Nachdenkens zu entheben scheint. Durch den Gedanken an den ewigen Fortschritt ist der Historiker in die angenehme Lage versetzt, immer von einem Zusammenhang und vielleicht auch von einer Notwendigkeit des Laufes der Dinge zu sprechen, da überall wo etwas zu Grunde geht, irgendwo und irgendwie auch etwas neues entsteht oder geschieht und mithin der Fortschritt nachgewiesen zu sein scheint. Daß hiebei unvermerkt der Begriff der Bewegung mit der Vorstellung des Fortschritts verwechselt wird, bleibt unbeachtet. Indem man aber den Begriff einer Fortschrittsentwicklung eingeführt hat, während in Wahrheit nur von Ursachen und Wirkungen geredet werden dürfte, werden die Beobachtungen äußerlicher Thatsachen zu Aeußerungen von innerlich wirkenden Gesetzen umgewandelt, welche den Fortschritt hervorgebracht haben sollen. Ohne Zweifel ist es der Mensch, der den zweiräderigen Karren und auch den Eisenbahnwagen gemacht hat; wenn dieser so viel schneller läuft als jener, so ist dies ein Fortschritt des laufenden Gefährts; der Mensch, der darin sitzt, ist derselbe geblieben, und sein erfindungsreicher Sinn zeigt sich in gleicherweise in der uralten Herstellung des Rades, wie in der complicirten Maschine der Neuzeit. Wollte jemand im Ernste behaupten, daß Plato oder Dante geringere geistige Eigenschaften (45 ≡)
besessen hätten als Stephenson, weil dieser ein Bewegungswerkzeug geschaffen hat, von welchem jene sich nicht einmal etwas träumen lassen konnten, so wäre das nicht besser, als die vielfach umgekehrt lautende Folgerung, daß die heutigen Geschlechter physisch schwächer und unvollkommener seien als früher, weil ja die Fabeln von den Titanen, Riesen, Herkules und Siegfried schon vor Jahrtausenden erfunden worden sind. Alle auf die Vervollkommnung der menschlichen Eigenschaftsvererbung gerichteten Fortschrittsideen müssen der Frage gegenüber verstummen, ob irgend jemand im menschlichen Gehirn einen einzigen logischen Vorgang bemerkt habe, den nicht Aristoteles bereits gekannt und beschrieben hätte. Auch die Geschichtserkenntnis selbst beruht durchaus auf der Annahme, daß der Mensch der Geschichte, soweit er in seinen Eigenschaftsüberlieferungen von einer Generation auf die andere sich dargestellt hat, immer derselbe war. Daß wir die Menschengeschichte zu verstehen in der Lage sind, und das, was Väter und Vorväter erlebt und gethan haben, nachempfinden können, ist nur dadurch erklärlich, daß wir dem vergangenen Menschen genau dieselben Gedankengänge und dieselben Beweggründe seiner Handlungen zuschreiben dürfen, die wir bei dem gegenwärtigen und lebenden wahrnehmen. Wäre jener in seinem Wesen anders geartet gewesen als wir selbst, so würde jede Sicherheit des Verständnisses seiner Ueberlieferungen aufgehoben sein und es wäre thöricht, zu denken, daß man eine Geschichte Agamemnons oder Karls des Großen zu schreiben im Stande wäre. Die Mittheilungen, die eine Generation der andern zu machen hatte, wären alsdann nicht besser als das Gezwitscher der Waldvögel, welches wir hören und von dem wir wol überzeugt sind, daß es allerlei zu bedeuten hat, denn wir verstehen die Sprachen der Thiere unvollkommen. Denken wir uns den Menschen der Vorzeit, selbst den Pfahlbauer, den Südseeinsulaner, so ist es möglich von ihnen allerlei zu wissen wie man von den Fischen, von den Kohlen, die in der Erde verbrannt liegen, eine sehr merkwürdige Geschichte erzählen kann, aber was man Geschichte im Sinne der Erkenntnis des Wollens und Thuns, des Gelingens und Leidens vergangener Geschlechter zu nennen pflegt, dies alles als Mitempfindung (46 ≡)
erlebter und erstrebter Handlungen gedacht, kann nur da auf volles Verständnis rechnen, wo eine Gleichartigkeit ererbter Eigenschaften von Generation zu Generation vorausgesetzt wird. Der wahre Geschichtschreiber entwickelt in dieser Beziehung in sich eine ungemein große Feinfühligkeit. Selbst wenn er von anderen Nationen oder gar von anderen Rassen erzählen soll, so fehlen ihm nicht selten Stimmung, Wahlverwandtschaft, Sinn und Auffassung, man darf sagen das Organ des Verständnisses. Er sucht sich erst auf alle Weise vorzubereiten, er lernt die Sprache fremder Menschen, er studiert die Länder und deren Natur, in der sie wohnen, er nähert sich dem Vorstellungskreise, welchen das nicht verwandte Volk von Vätern auf Söhne vererbt hat und dadurch als etwas selbstverständliches betrachtet. Geschichtserkenntnis im höchsten Sinne ist nicht nur ein Produkt der Beobachtung von Thatsachen, die sich darbieten, wie die Wandlungen der Erdrinde, wie die Eigenschaften der Elemente, die Erscheinungen der Wärme, des Lichts, der Elektricität, sondern auch eine Folge der Vererbung des gleichen Wesens der Eigenschaften in einer langen Reihe von Generationen. Die wesentliche Unveränderlichkeit des geschichtlichen Menschen macht die Geschichte möglich und die Geschichte beweist umgekehrt, daß sich seit Jahrtausenden derselbe im Wesen gleich geblieben ist. Was sich verändert hat, sind Werke seiner Hände, oder wenn man lieber will, seiner Kunst. Er selbst war immer dasselbe werkzeugschaffende Wesen, so lange ihn die Geschichte beobachtet hat, so lange ihm das Bewußtsein seiner Aehnlichkeit genealogisch erkennbar war. Den Fortschritt in den Dingen, die sein Schaffen hervorbringt und seine Kunst in Jahrtausenden geschaffen hat, zu verkennen, wäre dieselbe Täuschung, wie wenn sich jemand nicht überzeugt halten könnte, daß die Berge der Schweiz höher sind als im Harz, weil er sie ja nicht nebeneinander sehen kann. Diese Fortschrittsfrage ist in der That keine Frage, es dürfte davon nicht geredet werden. Ranke hat sofort in der klaren und weltweisen Einfachheit seiner historischen Denkungsart das Wort vom „technischen Fortschritt“ selbstverständlich aus der Reihe allgemeiner Probleme der Geschichte gestrichen; wenn er den Fortschritt überhaupt bezweifelt hat, so dachte er an eine Frage, die (47 ≡)
sich auf die durch Zeugung und Abstammung sich vererbenden und verändernden Eigenschaften des historischen Menschen bezog. Wahrlich nicht daran wollte der Altmeister gerührt haben, daß sich das Jahrhundert nicht freuen sollte, daß es das erfindungsreichste gewesen, daß es mit dem elektrischen Funken zu schreiben und zu sprechen versteht; er wollte nur sagen, daß auch das frühere schon verstanden hat, dem Himmel den Blitzstrahl zu entreißen. Wie klein dachten doch jene von dem gewaltigen Kenner menschlicher Größe, wenn sie um ihre vermeintliche Fortschrittsidee zu retten, ihm entgegen hielten, wie herrlich weit wir es gebracht hätten. Für diesen Fortschritt bedarf es keiner besonderen Beweise von Seiten der Geschichte, jeder Fabriksarbeiter stellt ihn dar, wenn er das Eisen hämmert oder die Dampfmaschine in Bewegung setzt. Er vermag mit einem Drucke seiner Hand ungemessene Lasten zu ziehen oder mit dem Wandervogel in Schnelligkeit zu wetteifern, und ist selbst doch wol nicht besser, als der Kohlenbrenner vor tausend Jahren war, der im tiefen Urwald nichts wußte, als daß das Feuer seines Meilers in steter Dämpfung brennen sollte. Was der große Geschichtsdenker den technischen Fortschritt nannte, begleitet in seiner concreten Bedeutung den Gang des Menschen in jeder Epoche, und nichts kann erfreulicher sein, als die gewaltige und erstaunliche Fülle dieser Fortschritte in zusammenfassender Geschichte der Cultur der Menschheit in allen ihren Theilen und Zweigen und Besonderheiten aufzuzeigen. Wollte man aber den Fortschritt im handelnden und thätigen Subject und nicht in den Ergebnissen seiner Arbeit suchen, so müßte der Nachweis gefordert werden, daß im Laufe der Generationen an den Individuen selbst Veränderungen eingetreten seien, die in Rücksicht auf bestimmte vererbte Eigenschaften in physischer, intellektueller oder moralischer Beziehung als Vervollkommnungen aufgefaßt werden könnten. In diesem durchaus genealogischen Sinne hat Ranke das Fortschrittsprinzip verworfen und indem er, der außerordentlichste Kenner der menschlichen Natur, während einer Vergangenheit von mehr als dreitausend Jahren wol berechtigt war zu bekennen, daß er in dieser Beziehung keine wesentlichen Variabilitäten wahrgenommen habe, vermochte er gegenüber den Unklarheiten und (48 ≡)
Dunkelheiten des Fortschrittsbegriffs dem ganzen Problem ein für allemal eine exakte Grundlage zu schaffen, von welcher die wissenschaftliche Genealogie nicht mehr abzusehen vermag. Man dürfte heute, wo die Frage auch entfernt noch nicht durch Einzelstudien spruchreif geworden ist, sich keineswegs bei einer blinden Anerkennung und einfachen Wiederholung des Rankeschen Standpunktes beruhigen; historische und naturwissenschaftlich genealogische Beobachtungen der schwierigsten Art müssen ineinander greifen, um zu einigermaßen gesicherten Resultaten zu gelangen, aber auch schon die ganz allgemeinen Erwägungen mögen erkennen lassen, daß man auch das genealogische Problem ohne sorgfältige Analyse der im Begriffe des Fortschritts liegenden Besonderheiten nicht wol lösen könnte. Auch vom Standpunkt der reinen Speculation hat schon Kant in der unendlich vorsichtigen Weise, mit der er alle Entwicklungsfragen und besonders diejenigen historischer Zeiten behandelte, dem Fortschrittsproblem eine speziellere Seite abzugewinnen gewußt, wodurch der Annahme einer Vervollkommnung des Individuums in geschichtlicher Entwicklung eine wenigstens denkbare Unterlage gegeben werden sollte. Indem er die Gesellschaftszustände als solche historisch einer Vervollkommnung fähig hielt, die von einem philosophischen Kopf in dem Gange zu einem weltbürgerlichen Ziel erblickt werden könnte, und wonach die Geschichte selbst einem fortschreitenden Gesetze unterstehen würde, dachte Kant das hierbei thätige Individuum – den geschichtlich wirkenden Menschen – in einer fortwährenden Auswicklung der in ihm vorhandenen Fähigkeiten und Kräfte begriffen. Die Vervollkommnung des Gesellschaftszustandes, welche gleichsam durch künstliche Veranstaltung, wie das immer mehr verbesserte Werkzeug, des Werkmeisters hervorgebracht ist, wäre darnach nicht Selbstzweck, sondern müßte als Mittel gedacht werden, um die in der Menschheit im ganzen und in jedem einzelnen vorhandenen Anlagen vollends zur Reife zu bringen. In diesem Verstande müßte also, wenn nicht eine qualitative, so doch eine quantitative Veränderung der Eigenschaften von Geschlecht zu Geschlecht vor sich gehen und in den aufeinanderfolgenden Generationen würde ein For[t]schritt des Könnens und (49 ≡)
Vermögens eine Schlußfolgerung auf die Erhöhung und Vermehrung innerer, sei es physischer, psychischer oder moralischer Kräfteverhältnisse gestatten. So schwierig und zweifelhaft selbstverständlich der empirische Nachweis einer solchen von Kant geforderten Auswicklung von Anlagen in den Generationen sein mag, so sicher erhält durch diese Auffassung des Fortschritts die genealogische Forschung eine Aufgabe, der sie sich nicht entziehen könnte. Die ältere Psychologie, die mit dem Begriff der Vermögen hauptsächlich arbeitete, konnte sich freilich leicht mit der Vorstellung eines solchen quantitativen Fortschritts befreunden, während der Versuch etwas meßbares und vergleichbares in dieser Beziehung bei der Bewerthung der von Geschlecht zu Geschlecht vererbten Eigenschaften zu finden, jedenfalls sehr schwierig sein müßte. Vergleicht man indessen den von Kant aufgestellten Fortschrittsbegriff mit den brutalen Aufstellungen früherer oder späterer Utopisten, so muß man ohne Zweifel erkennen, daß ganz so wie bei dem Geschichtsdenker, so auch bei dem Philosophen die Forderung maßgebend bleibt, nicht bei den äußerlichen Erscheinungen und Wirkungen stehen zu bleiben, sondern in die Frage der Vervollkommnung auf dem Wege der inneren Veränderungen der Menschen selbst einzutreten, d. h. das Problem genealogisch zu fassen. Ganz unverständlich wäre dagegen aus dem genealogischen Standpunkt die Annahme einer Gesetzlichkeit des objektiven Fortschritts, bei welcher Vorgänge physiologischer oder psychologischer Natur in den Zeugungs- und Abstammungsverhältnissen ausgeschlossen wären oder wenigstens ganz außer Betracht bleiben könnten. Wenn das Geschehene, in welchem sich der menschliche Fortschritt als gesetzlich waltende Macht zeigen soll, doch ohne alle Frage den handelnden Menschen voraussetzt, so wird die veränderte Wirkung nicht ohne veränderte Ursache zu Stande gekommen sein und da die sich verändernden Ursachen der historischen Wirkung nur in den Eigenschaften der sich verändernden Generationen liegen können, so wird daraus folgern, daß es kein Fortschrittsgesetz geben könne, welches nicht ein Gesetz der Variabilität der Eigenschaften der als Ursachen wirkenden Menschen wäre. Ob aber eine solche fortschreitende Variabilität überhaupt besteht und nachgewiesen werden (50 ≡)
kann, ist wiederum eine Frage der Genealogie und kann ohne die empirische Untersuchung des Verhältnisses von Zeugungen und Abstammungen nicht beantwortet werden. Wenn dagegen immer wieder die Versuche gemacht worden sind, abgezogen von den concreten vererbten oder veränderten Eigenschaften der Menschen historische Entwicklungsgesetze aufzustellen, so scheint es begründet zu sein, daß auch der gewöhnliche Historiker, der zunächst gar nicht das genealogische Problem in Rechnung zieht, eine gewisse Abneigung gegen dergleichen Aufstellungen zu haben pflegt. Zunächst wird es ihm bedenklich sein, und wieder ist es Ranke, der diese Vorstellungsweise an der Masse seiner historischen Menschenkenntnis zu corrigiren verstanden hat, daß durch ein solches objektiv wirkendes Gesetz ein Zwang ausgeübt wird, unter welchem alle individuelle Thätigkeit zu einem bloßen Schein herabgedrückt würde. Ranke hat sich nicht gescheut, sogar eine Art von Ungerechtigkeit Gottes in dem vermeintlichen Bestande eines die geschichtlichen Dinge ein für allemal bestimmenden Willenplans zu erblicken. In der That wird eine Geschichtsphilosophie, die sich oder andere glauben machen will, daß alles historische Leben ein für allemal einem feststehenden Fortschrittsgesetze unterworfen sei, den geschichtlich denkenden und empfindenden Forscher bis zu einer Leidenschaft des Abscheus erbittern müssen, weil die Vorstellung der völligen Unfreiheit, unter der die historische Handlung vollzogen sein müßte, das spezifisch geschichtliche Interesse an dem Gegenstande sofort und mit Notwendigkeit aufhebt. So urtheilten Goethe und Alexander von Humboldt über die Erfindung historischer Gesetze, während sie das lebhafteste Interesse und Auffassungsvermögen geschichtlichen Vorgängen gegenüber besaßen. Und wenn Schopenhauer der geschichtlichen Erkenntnis überhaupt die Möglichkeit bestritt, zu einem Allgemeinen zu gelangen, dem sich das einzelne subsummiren lasse und meinte, daß alles historische immer nur auf dem Boden der Erfahrung weiter krieche, so ist es durchaus falsch ihm vorzuwerfen, daß er dadurch die Geschichte als Wissenschaft herabsetzen wollte, er verwahrte sich bloß gegen den Nebel eines Fortschrittsgesetzes, welches man außerhalb der durch Zeugung und (51 ≡)
Abstammung bedingten Individualitäten erkennen zu können vermeinte. So wahrhaft glücklich und herzlich froh indessen den echt historisch empfindenden Geist die Beobachtung der Ungebundenheit des handelnden Menschen in der Geschichte machen wird, und so abstoßend die Zwangslage des Weltenplans, des Fortschritts, des Entwicklungsgesetzes auf die größten Geister gewirkt hat, so entfernt ist doch ein jeder davon, zu verkennen und zu leugnen, daß in den objektiv vorliegenden und zu beobachtenden Thatsachen sich fortwährend gewisse Wiederholungen und Regelmäßigkeiten darstellen, die sich durchaus mit dem vergleichen lassen, was der Naturforscher Gesetze nennt. Wenn der Meteorolog eine Beobachtung gemacht hat, nach welcher die Winde sich nach einer gewissen Regel verändern, so findet der Historiker nicht wenig Thatsachen, die auf der Wiederkehr und dem Wechsel von Ideen und Geschmacksrichtungen beruhen, von welchen Individuen, oder ganze Generationen erfüllt sind. Die reiche Fülle von Ergebnissen menschlicher Handlungen, welche die Statistik nachweist, zeigt in der nach Ursache und Wirkung geordneten systematischen Darstellung die größte Aehnlichkeit mit dem, was der Naturforscher ein Gesetz nennt; und wie sich diese Wissenschaft als die Schlußbilanz historischer Erscheinungen in gewissen Zeiträumen bezeichnen läßt, so lassen ihre Gesetze einen Rückschluß auf die Wandlungen der Eigenschaften zu, welche die Personen besaßen, die als Urheber des Zustandes anzusehen waren. Wenn die Statistik ihre genaue Rechnung über Heiraten und Geburten macht, so vermag sie die Ursachen der Vermehrung und Verminderung durch mannigfache Combinationen zu ergründen suchen, darüber aber wird kein Zweifel sein, daß alles von den individuellen Acten einer zeitlich zusammgefaßten Generation, einer gewissen Classe der Bevölkerung, oder einer Familie abhing, deren Eigenschaften hinwieder bestimmt worden sind durch Vererbung derselben von den Vorfahren. Geht man nur demjenigen, was sich als regelmäßige Erscheinung in den historischen Begebenheiten erfassen läßt, tief genug auf den Grund, so darf man wol sagen, daß selbst die scheinbar äußerlichsten und unpersönlichsten Thatsachen, die sich fast wie die (52 ≡)
Prozesse der Chemie und Physik zu entwickeln scheinen, Thatsachen des allgemeinen Culturlebens, oder der Verfassung am letzten Ende doch immer nur aus den Erbschaftsqualitäten bestimmter Individuen ergeben, und auf diese zurückgehen, wie der Topf zum Töpfer, wie das Bild des Zeus zu Phidias und der steinerne Moses zu Michelangelo. Man kann um Beispiele nicht verlegen sein: die alte Beobachtung des Aristoteles, die sich auf den Wandel der Verfassungsformen bezog, wobei sich der Denker rein in die Form vertiefte, in Grundformen und Nebenformen eine erstaunlich wechselnde Regelmäßigkeit erkannte, scheint auf den ersten Blick fast wie eine Sache mathematischer Abstraction, man glaubt fast jedes Gedankens an eine individuelle Willensaction entrathen zu können, wie wenn es sich um ein Kräfteparallelogramm handelte. Aber als Gervinus fast mit leidenschaftlicher Sicherheit die alte aristotelische Weisheit als Entwicklungsgesetz des 19. Jahrhunderts verkündete, war man weit entfernt sich die Sache als mathematischen Calcül gefallen zu lassen und wie den Pythagoräischen Lehrsatz hinzunehmen, vielmehr war man geneigt den demokratischen Propheten einzusperren und der klagende Staatsanwalt wurde, so thöricht und bedauerlich auch der Prozeß gegen Gervinus war, doch von niemand einer Versündigung gegen die einfachsten Denkgesetze beschuldigt. Und trotzdem wird heute wiederum jedermann gern zugestehen, daß in der Gervinusschen Theorie, nach welcher das Jahrhundert mit einem Siege der Demokratie schließen sollte, immerhin ein Fünkchen Wahrheit gelegen habe; man dürfte nur seine Behauptung nicht in jener großartigen Allgemeinheit fortschrittsgesetzlicher Einbildung, sondern in der bescheidenen Fassung individueller geistiger Veränderungen verstanden haben, vermöge welcher man am Ende des Jahrhunderts allerdings eine Generation lebend und wirkend wahrnimmt, die mit einer überraschenden Masse von demokratischem Oel gesalbt, oder wie andere vielleicht lieber sagen werden, beschmiert ist. Man sieht also, daß Gervinus unter dem Gesichtspunkte großartiger historischer Fortschrittsgesetze nichts zu Stande brachte, als die Fanfaronade einer alten Aristotelischen Beobachtung; auf dem bescheidenen Standpunkte der (53 ≡)
Genealogie dagegen wird sich seine Prophezeiung für genugsam begründet erachten lassen, wie die Ziffern beweisen, welche über die Gesinnungen und Ideen der Enkel und Kinder von 1830 und 1848 alljährlich in allen europäischen Ländern Auskunft geben. Genealogisch betrachtet läßt sich gewiß nicht bezweifeln, daß die Denkungweise der seit dem Anfang des Jahrhunderts erzeugten Geschlechter in immer breiteren Massen in ganz Europa den monarchischen Ideen entfremdet wurde, und daß eine Stimmung, eine Pietätsempfindung, mag man sie psychologisch oder physiologisch erklären wollen, sich thatsächlich im Vererbungsprozeß der Generationen verloren hat und eine große Zahl von Söhnen und Enkeln nun hassen, was die Väter geliebt und lieben was diese gehaßt haben. Hätte sich Gervinus bei seiner demokratischen und republikanischen Weissagung damit begnügt auf diesen voraussichtlichen Wechsel der Gesinnungen und Gefühle der europäischen Menschheit hinzuweisen, so würde man ihn wol kaum, wie es nun kleinmeisterliche Weisheit thut, belächeln können, wobei man überdies nicht vergessen dürfte, daß der ruhige Bestand der Republik in Frankreich immerhin auch beweisen kann, daß so ganz thöricht die Beurtheilung des historischen Charakters des 19. Jahrhunderts, Seitens des geistreichen Mannes nicht gewesen ist. Aber sein Irrthum bestand in dem Glauben an die abstrakten Entwicklungsgesetze, an die Fortschrittstheorie. Denn wer von diesen Dingen spricht, darf sich nicht in den Fall gesetzt sehen, daß die Ausnahmen größer sind, als die Regeln, gegen die sich der zufällige Gang der Ereignisse fortwährend sträubt und empört. Was man thatsächlich bemerkt ist ein steter Wechsel von Gesinnungen und Handlungen in den thätigen Generationen der Menschen und in dem speziellen Fall der Verfassungsfragen des 19. Jahrhunderts ein mechanischer Wandel monarchischer und demokratischer Willensäußerungen, ein Wachsthum überlieferter Ideen hier und ein Rückgang dort - der Naturforscher könnte sich leicht bestimmen lassen das ganze unter die Kategorie der Variabilitäten in der Vererbung zu stellen. Doch so rasch wird sich der Genealog vielleicht nicht entschließen können, das große Problem als ehrlich gelöst zu betrachten, denn was in der Geschichte unter den handelnden (54 ≡)
Menschen als Resultat hervortritt, sind lauter Produkte von hunderterlei Umständen, bei denen sich keine Empirie für überzeugend genug erwies, um eben Zeugung und Abstammung als erste oder gar als die einzige Ursache der Erscheinungen annehmen zu können. Es ist klar, daß man hier vorsichtig zu Werke gehen muß. Bei der objektiven Betrachtung historischer Erscheinungen erregt es unser größtes Erstaunen, daß überall da, wo man gewisse Ueberzeugungen, Gedanken, Gesinnungen - alles was man unter Ideen zu begreifen pflegt - als die Triebfedern der Handlungen wahrnimmt, die mannigfaltigsten Wirkungen aus derselben Ouelle entspringen. Auf die psychologisch zu erklärenden Vorgänge im Leben der Generationen angewendet, ergibt sich aus solchen Erscheinungen eine Art von Charaktereigenschaften, die dem Spiel der Wellen vergleichbar sind. Man denke an die Idee der Volkssouveränetät. Aus ungeahnter Tiefe der Zeiten und der gesellschaftlichen Zustände emporsteigend, hat sie Form und Gestalt oft mannigfaltig gewechselt. Sie hat im fünfzehnten Jahrhundert den Mord des Herzogs von Orleans zu rechtfertigen verstanden, und sie hat mit der Gelehrsamkeit des Jesuitismus den staatskirchlichen Absolutismus eines Philipp II. vertheidigt, sie hat dann durch ein Jahrhundert geschwiegen und in wiedererwachter Gestalt die große Revolution hervorgebracht. Auch die Erscheinungen, die man heute mit dem Namen der Frauenemanzipation nicht eben sehr treffend bezeichnet, vermöchte wol kein Kenner vergangener Culturzustände als eine in allen einzelnen Theilen neue Sache zu betrachten. Namentlich ist der Antrieb der Frauen sich der gelehrten Bildung ihrer Zeit zu bemächtigen, im 16. und im 10. Jahrhundert ganz ebenso groß gewesen, wie im 19. Auch der heutige soziale Gedanke den Frauen eine auf sich gestellte Wirksamkeit zu sichern, hat im kirchlichen und Klosterleben vergangener Zeilen seine vollen Analogien. Wenn man nun die Ursachen dieser im Wechsel der Zeiten sich ganz regelmäßig wiederholenden Erscheinungen erforscht, so ist doch unzweifelhaft, daß mindestens einen mächtigen Antheil daran jene Antriebe, jene Bewegungen haben müssen, die in den persönlichen (55 ≡)
Eigenschaften eben der nach der sogenannten Emanzipation in ihren verschiedenen Formen und Zeiten strebenden Frauen selbst begründet waren. Indem also die Frauenfrage im Wechsel der Zeiten bald mehr und bald weniger hervortritt, beweist sie für die aufeinander folgenden Geschlechter eine gewisse Wiederkehr frauenhafter Eigenschaften, die in gewissen Epochen unzweifelhaft weit mehr von männischer Art sind als in anderen, wo in denselben Zügen etwas geradezu häßliches erblickt worden ist. Dem Wechsel der seelischen Stimmungen, der sich in der Frauenfrage zeigt, innig verwandt sind die allermeisten Erscheinungen aus dem Gebiete des sozialen Lebens. Daß man die vollständige Identität aller jener Bewegungen, die sich in den unteren Schichten der Bevölkerungen gegen die oberen fast in jedem Jahrhundert wiederholen, heute nicht deutlicher zu erkennen und zuzugestehen pflegt, kommt lediglich daher, weil man das, was heute mit weit hochtönenderen Namen bezeichnet wird, in den früheren Zeiten einfach Bauernkriege nannte, wobei man an nichts als an jenen Gegensatz der Arbeiterklassen zu denken pflegte, welche jetzt den gleichen Kampf führen. Einer der wenigen Praktiker, die den gemeinsamen Charakter der „sozialen Frage" am Anfang des 16. und am Ende des 18. Jahrhunderts erkannt hatten, war der erste Napoleon, der von Karl V. meinte, er hätte sich der Bauern gerade so gut zur Aufrichtung einer neuen Macht bedienen können, wie der Tyrann des 19. Jahrhunderts der Demokratie. Die Geschichtsforschung vermag mit immer tieferer Erkenntnis der Dinge nachzuweisen, daß zwischen den wiedertäuferischen Lehren und den sozialistisch-communistischen Theorien kaum noch ein Unterschied in Wesen der Sache, sondern höchstens in den Formen und Mitteln besteht, allein Beobachtungen dieser Art läßt sich der Eigendünkel keiner Zeit gerne gefallen, und so wollen merkwürdigerweise Regierung und Regierte nicht viel davon hören, daß die ganze Comödie der Irrungen, die man heute sozialdemokratisch aufführt, eben uralte Geschichten sind. Nichts destoweniger bleibt es gewiß, daß alle Erscheinungen in dieser Richtung eine Regelmäßigkeit der Wiederkehr erkennen lassen, die sich doch nur dann erklären läßt, wenn man Eigenschaften in Betracht nimmt, die von Geschlecht zu (56 ≡)
Geschlecht dem geschichtlich thätigen Menschen anhaften und immer wieder zur Aeußerung gelangen müssen, weil sie auf Zeugung und Abstammung beruhen, und eben vermöge der Vererbung nach ihren äußeren Wirkungen hin den Schein eines objektiv wirkenden Gesetzes erregen. Statt nun in diesem genealogischen Problem den eigentlichen Gegenstand der Forschung aufzudecken, zeigt man mehr Neigung irgend einen Plan zu enthüllen, der in dem Gange der Geschichte zum Ausdruck kommen soll. In Wahrheit sind es aber die in den Menschen forterbenden Gebrechen und Bedürfnisse, welche dieselben Wirkungen erzeugen und wenn die Philosophen des vorigen Jahrhunderts sehr viel von den angeborenen Menschenrechten sprachen, so standen sie damit einer genealogischen Beobachtung eigentlich nicht ganz ferne, sie suchten nur eine Lösung auf einem Gebiete, welches selbst von der dem Menschen angeborenen Natur nicht unabhängig und nicht zu trennen war. Wenn jemand sagen sollte, was sich seit den Zeiten der Jaquerie in den Bewegungen und Kämpfen der unteren Stände gegen die oberen im wesentlichen geändert habe, so wird er zwar in den Gegenständen der Beschwerden und Leiden des einen Theils und in der Natur der Uebergriffe und Sünden des anderen deutliche Unterschiede wahrnehmen können, aber die subjektive Grundlage des ganzen Kampfes müßte er doch als unverändert und unveränderlich anerkennen. Es handelt sich heute nicht um Frohndienste und Leibeigenschaft, nicht um den Fisch im Wasser und den Vogel in der Luft, es handelt sich um Lohn und Arbeitszeit, aber auch um Eigenthum und Erbe. Wo ist der Unterschied? Sind es nicht dieselben angeborenen Eigenthumsbegriffe auf der einen Seite und dieselben menschheitlichen Gleichheitsbegehrungen auf der andern Seite, die mit einander ringen; und was im Laufe der Geschlechtsreihen immer wieder zum Vorschein kommt,ist es nicht eine Regelmäßigkeit, die sich lediglich aus der unveränderten Natur natürlicher Zeugungs- und Abstammungsverhältnisse erklärt? Was sich davon als äußerliche Wirkung geschichtlich zu erkennen gibt, ist das Auf- und Abwogen dieses sozialen und moralischen Meeres. Welle auf Welle stürzt sich und drängt sich zum Ufer und immer wieder wird sie gebrochen und fällt in sich selbst zusammen, aber wie sagt doch (57 ≡)
der Dichter: „Aber das Meer erschöpft sich nicht.“ Wer am Ufer steht und zusieht kann wol eine Art von Gesetz darin finden, wie sich mit mathematischer Sicherheit in gewissem Zeitmaß die Wogen aufeinander folgen. aber indem er sich dieser Beobachtung erfreut, ist seine ganze Weisheit auch schon am Ende. Wenn er die Natur des Menschen betrachtet in dessen Geschlechtsreihen die sozialen Wellen ihr Spiel treiben, so wird er nichts als den tausendjährigen Wunsch und Antrieb nach dem tausendjährigen Reich entdecken. Der Chiliasmus treibt sein Wesen durch alle Zeiten hindurch, er lebt und webt unter mannigfaltiger Standarte, aber irgend etwas anderes, als das Vorhandensein von chiliastischen Träumen in den Seelen unzähliger Generationen ist damit nicht zu ersehen. Wenn der Historiker diesen gesellschaftspsychologischen Zustand untersucht, so stellt er sich eigentlich nur auf den Standpunkt eines nach wissenschaftlichen Erfahrungsgrundsätzen arbeitenden Pathologen; er sollte sich, wie dieser auch nicht durch eine falsche Fortschrittsidee zu der Meinung verleiten lassen, daß es eine Zeit geben werde, wo die Menschen nicht mehr krank sein werden. Neben den von Geschlecht zu Geschlecht forterbenden historischen Beweggründen scheinen solche, die nur von Zeit zu Zeit auftreten, genealogisch genommen, fast noch mehr Interesse zu bieten. So spielt der politische Mord in der Geschichte eine Rolle, für welche die objektive Geschichtsforschung in keiner Weise eine Erklärung zu geben vermöchte, wenn sie nicht auf die persönlichen Bedingungen einginge, unter denen solche Thatsachen eintreten und oft völlig veränderte Richtungen in dem Leben eines ganzen Staates zur Folge haben. In Rußland sind seit Peter III. bis Alexander III. von den sieben Monarchen nur drei eines natürlichen Todes gestorben; auf die Staatsoberhäupter von Frankreich sind seit 1815 so viele Attentate versucht worden, daß die stete Wiederholung dieser Thatsachen eine Art von Regel bildet. Vergleicht man ferner die politischen Morde bei den lateinischen Völkern, mit denen bei den germanischen Rassen, seit etwa 600 Jahren, so kann man sagen, es sei eine Charaktereigenschaft der slavischen und romanischen Nationen, die in den politischen Mordthaten und Versuchen zum Ausdruck kommt. Man schließt hier aus der Häufigkeit derselben (58 ≡)
politischen Thatsachen auf eine Eigenthümlichkeit der individuellen Beschaffenheit, die sich bei verschiedenen von einander abstammenden Menschen verschieden entwickelt. Die historische Thatsache des häufigen Vorkommens des politischen Mordes bei den einen gegenüber den andern ist mithin nicht objektiv zu erklären und begreifen, sondern es liegt etwas zu Grunde, was auf Vererbung von einem Geschlecht auf das andere beruht. Sehr interessant ist die in neuester Zeit wieder hervortretende Neigung, die Vertretungskörper verschiedener Nationen mit tödtlichen Waffen anzugreifen, denn auch dieses seltsame Verbrechen ist in der That in keiner Weise als etwas neues zu betrachten. Die englische Pulververschwörung beweist, daß vor 300 Jahren bereits eine solche Unthat von einer erheblichen Zahl von Genossen als eine politisch erwünschte Handlung angesehen worden ist. Sehr sonderbar würde sich die heule wiederholte Thatsache aber darstellen, wenn man auf diese Vorgänge das beliebte historische Entwicklungsgesetz und die Annahme eines menschheitlichen Fortschritts anwenden wollte. Da müßte der Fortschritt darin gesehen werden, daß die Verschwörer vor dreihundert Jahren soviele Fässer Pulver nötig zu haben glaubten, während der heutige Anarchist seine Bombe vergnügt in seiner Tasche trägt. Wollte man aber auch in dieser technischen Vervollkommnung der Mordwerkzeuge das Wirken des Fortschritts nicht läugnen, so müßte man doch andererseits zugestehen, daß bei den dabei in Betracht kommenden Personen in gewisser Beziehung ein Rückschritt bewiesen werden kann, denn offenbar gehörte ungleich mehr Muth und Ausdauer dazu, das Attentat von 1605 in Szene zu setzen, als eine Bombe in einen Saal voll Menschen zu schleudern. Kaiser Napoleon III. hat einmal die treffende Bemerkung gemacht, daß die Attentäter früherer Zeiten mutigere und entschlossenere Leute gewesen wären als die heutigen, denn indem sie mit dem Dolch auf ihr Opfer losgingen, waren sie demselben wirklich gefährlich und in ihrem Verbrechen fast immer erfolgreich, da sie ihr eigenes Leben einsetzten, während der Bombenwerfer davon zu laufen und sich zu retten beabsichtigt. In der That zeigt nichts deutlicher als die Geschichte der Verbrechen und insbesondere die der politischen Verbrechen, wie wenig (59 ≡)
hier mit dem objektiven Entwicklungsgesetz anzufangen sei. Hingegen läßt sich durch die genealogische Betrachtung dieser so steten Wiederholung scheinbar ganz zufälliger Umstände, wie Attentate, das Räthsel leicht lösen, denn durch den immer wieder erwachten tigerartigen Trieb gewisser Charaktere, die zwar als Individuen starben, aber immer neugeboren wurden, ist eine Motivengleichheit erkennbar, die in der nie abbrechenden Vererbung der menschlichen Eigenschaften ausreichend begründet ist. Es ist klar, daß man hier an dem Punkte einer ungeheuren Aufgabe steht, welche die Genealogie in Verbindung und im Dienste der Geschichte zu erfüllen hat. Es ist gleichsam nur ein aus dem Dunkel führender Weg, dessen Weite sich vor uns zu entwickeln scheint. Was auf demselben den Sterblichen zu sehen und zu erkennen beschieden sein mag, sind natürlich nur die kleinsten Segmente eines ungeheueren Kreises von Vorgängen, zu deren Erklärung überhaupt nicht eine einzelne Wissenschaft, sondern der Inbegriff alles wissenschaftlichen Arbeitens und Denkens erforderlich sein würde. Die Geschichtsforschung übernimmt nur aus den Beobachtungen über das gesammte Dasein des Menschen einen kleinen Theil, um denselben zur Erklärung jener historischen Thatsachen zu benützen, denen sie ihr Interesse zuwendet. Sie ist genötigt, das menschliche Wesen mit Rücksicht und Kenntnisnahme seiner mannigfachen persönlichen, physischen und moralischen Qualitäten und im Hinblick auf alle Thätigkeit zu beachten, die von demselben zur Erfüllung seines gesellschaftlichen Zweckes und Daseins ausgegangen ist. Sie macht sich dabei so wenig zum Arzt wie zum Beichtvater des Menschen, aber sie kann seine Eigenart nicht entbehren, wenn sie von seinen Werken mit dem Anspruch des redlichen Verständnisses sprechen soll. Die Geschichtschreibuug ist in dem Falle des Bildhauers, der dem Helden eine Statue setzen soll. Alle Kenntnis von den Thaten desselben kann dem Künstler nichts nützen, wenn er von seinem darzustellenden Feldherrn nicht weiß, ob er eine lange Nase gehabt oder einen Bart getragen habe. Wer in diesen Stücken das Porträt verkehrt gemacht hat, wird sich über harten Tadel nicht beklagen können, wenn er die Geschichte der Thaten des Helden auch noch so gut (60 ≡)
studiert hätte, die ungenügende Kenntnis der Nase, des Mundes und der Ohren reicht hin um sein Standbild völlig verfehlt erscheinen zu lassen. So hat auch der Geschichtsforscher nur die Hoffnung, in die Motive Einblick zu gewinnen, wenn er den Urheber der Ereignisse in seinen Eigenschaften erkannt hat, und da in einer Reihe von Begebenheiten, welche die Lebenszeit eines einzelnen weit übersteigen, die Eigenschaften vieler Generationen in Betracht zu ziehen sind, so entspricht dem Laufe der Jahrhunderte eine Reihe von Vererbungen vieler aufeinander folgender Zeugungen. Es ist richtig, daß diese Art von Forschung, welche im strengsten Sinne des Wortes rein genealogisch vorgehen müßte, lange Zeiträume hindurch nicht durchführbar wäre. Es gibt unzählige werthvolle Ueberlieferungen der Geschichte, welche nichts als Thatsachen mittheilen, wie Virgil in Dantes Inferno massenhaft Schatten zeigt vom Namen getrennt. So wandern in vielen Epochen Thatsachen auf Thatsachen dahin, hinter denen sich nur die Schattenumrisse von Menschen zeigen, welche die Ereignisse hervorgebracht haben. Alle Feldzüge und Eroberungen Attilas geben von dem Hunnenkönig nicht den leisesten persönlichen Begriff, und wenn ihn Raphael malte, so ist sein Bild ein Produkt seiner Phantasie, aber auch nicht schlechter als das, welches der gelehrteste Historiker von ihm entwerfen mag. Alle Geschichte nimmt erst dann eine concrete Gestalt an, wenn sie genealogisch wird. Sie zeigt alsdann Personen, die unter uns zu wandeln scheinen, weil sie von vielen gekannt und beschrieben wurden und in dem Rahmen eines Porträts auf die Nachwelt gekommen sind, welches inmitten einer Ahnengallerie alle Merkmale individueller und familiärer Beurtheilung darbietet. Es versteht sich von selbst, daß die Geschichte jener Zeiträume, von denen uns fast nur Thatsachen und keine Personenreihen überliefert sind, nicht im mindesten weniger merkwürdig, oder werthloser ist. Es ist ganz berechtigt, daß das Interesse der Geschichtsforscher oftmals desto größer zu sein pflegt, je mehr man sich den dunkeln Jahrhunderten nähert, aus welchen wenig persönliches, außer verworrenen Nachrichten von tödtlichen Speerwürfen und tapferen Streichen gegen den Feind überliefert ist. Indem sie mit größtem Fleiße und tiefem Scharfsinn nach (61 ≡)
den „Zuständen“ forschen, vermögen sie vielleicht, eben weil der schwer zu berechnende Faktor der Wesenseigenschaften. aus denen sich das Produkt entwickelte, bei Seite geblieben ist, die objektiv vorliegenden Thatsachen in eine desto bessere Ordnung und in ein System zu bringen. Allein darüber kann keine Täuschung stattfinden: die Fortschrittsfrage kann auf diesem Wege nie und nimmer gelöst werden, weil alle Vervollkommnungen, von denen die Zustände noch so beredtes Zeugnis ablegen, nur zeigen können, daß das Produkt der menschlichen Hand ein besseres geworden, die Hand selbst aber die gleiche geblieben ist. Anders stände es natürlich mit der Frage des Fortschritts, wenn man durch Zeugungs- und Abstammungsverhältnisse belehrt werden könnte, daß der Mensch in seinen physiologischen, psychologischen und moralischen Eigenschaften selbst eine Verbesserung erfahren habe. Hier ist der Punkt, wo sich die genealogische Forschung auf die vollste Höhe naturwissenschaftlicher Bedeutung erheben würde, wenn es ihr gelänge, auch nur die kleinsten Resultate auf erfahrungsmäßigem Wege festzustellen. Daß sie dabei durchaus vom einzelnen ausgehen würde und nur aus der Sammlung von vielen einzelnen Fällen zu Schlüssen allgemeiner Art gelangen könnte, würde ihr dabei nicht zum Schaden gereichen, so lange der Triumphzug der inductiven Logik der neueren Wissenschaften nicht als eitle Täuschung angesehen werden wird. Indem die Genealogie mit ihrem wesentlichen Erkenntnisprinzip auf dem Grunde der Erblichkeit der Eigenschaften ruht, betrachtete sie das Fortschrittsproblem lediglich unter dem Gesichtspunkt einer Variabilität, die sie als eine Vervollkommnung des individuellen Wesens nachzuweisen und mithin als die Möglichkeit einer solchen in Absicht auf die Menschheit überhaupt zu erschließen vermöchte. Und wenn in dieser ohne Frage größten Sache menschlicher Wißbegierde die Genealogie auch nur eine leiseste Unterstützung anderen Wissenszweigen bieten könnte, so würde sie dadurch schon auf einen sehr hohen Standpunkt gehoben sein. Es kann selbstverständlich in einleitenden Worten nicht davon die Rede sein, daß die sich so gewaltig darstellenden Aufgaben einer gleichsam jungfräulich dastehenden Wissenschaft ohne weiteres erfüllbar (62 ≡)
seien, aber eine gewisse Vorstellung davon wird man sich doch bilden müssen, wie man sich der Lösung des Problems nähern könne. Hierbei darf es der Genealog ohne Zweifel den physiologischen und psychologischen Untersuchungen vollständig überlassen, wie die Vorgänge zu denken und erklären seien, die den als Eigenschaften erscheinenden Einzelwirkungen des Menschen zu Grunde liegen. Indem sich diese aber eines Theils auf das Gebiet materieller, anderntheils auf das Gebiet äußerlich unmeßbarer Kraftverhältnisse beziehen, so wird der Genealog von jenen anderen Wissenschaften auch jene Eintheilungen übernehmen dürfen, nach welchen die Eigenschaften in ihrer Vererbung von einem Individuum auf das andere, theils als physische, theils als intellektuelle, theils als moralische bezeichnet zu werden pflegen. Man kann wol behaupten, daß die Genealogie bei der Beurtheilung der physischen und moralischen Eigenschaften, soweit ihre Quellen reichen, ein weit leichteres Spiel haben dürfte, als in Bezug auf die intellektuellen, und man dürfte sich einer vollen Zustimmung zu erfreuen haben, wenn man behauptete, daß das vielberührte Fortschrittsproblem eigentlich in der Frage einer Vervollkommnung der letzteren Qualitäten wesentlich begrenzt erscheint. Indessen ist selbst in Betreff der physischen Kraftverhältnisse menschlicher Generationen, so viel auch darüber hin und hergeredet worden ist, und so vielerlei Vermutungen darüber ausgesprochen zu werden pflegten, eine gründliche historisch-genealogische Untersuchung niemals angestellt worden und wenn sich die einen einbilden, daß die Schwabenstreiche in den Kreuzzügen, die Uhland besungen hat, viel gewaltiger gewesen seien, als die der Kürassiere bei Mars la Tour, so weiß man solche kaum mit guten Gründen zu widerlegen, obwol es sich doch hier um ein Problem handelt, welches allen Ernstes zu untersuchen, vom Standpunkt vieler Wissenszweige sehr wichtig wäre. Aber hier fehlt es wiederum an der richtigen genealogischen Methode. Wer sich aus ein paar kulturhistorischen Momenten, erhaltenen Rüstungen, Waffen, Werkzeugen und dergl. über die Stärke und Schwäche der Menschen, sei es ein günstiges oder ungünstiges Urtheil, bilden möchte, indem er in den verschiedenen Zeiträumen der Welt umherspringt und bald da, bald dort eine Notiz erhascht, (63 ≡)
kann sich unmöglich einbilden über die Fortschrittsfrage etwas auszusagen, da sie doch ihrer Natur nach nur etwas stetiges sein kann und dabei die Voraussetzung gelten wird, daß in der Vererbung ein Gleichmaß der Zunahme oder Abnahme geherrscht haben müßte. Ganz anders würde aus dem genealogischen Wege verfahren werden, denn auf diesem gibt es keine Sprünge von einem Jahrhundert in das andere, alles kann nur von Vater ans Sohn und Enkel übergehen; diese Methode hält sich entweder an die Vergleichung von Abstammnngsreihen, oder sie existirt überhaupt nicht, denn nur aus der wirklichen Beobachtung der Väter und Söhne vermag sie Schlüsse zu ziehen. Nun könnte man freilich sagen, auch für die nächsten vergangenen Generationen werde man nicht im Stande sein, die physischen Kräfte mathematisch zu bestimmen, weil es darüber an den nötigen Experimenten im 19. Jahrhundert ebenso sehr mangelt, wie zu den Zeiten der Kreuzzüge, aber diese Einwendung läßt es nur bedauerlich erscheinen, daß ähnliche Forschungen von Geschlecht zu Geschlecht nicht schon früher unter den civilisirten Völkern begonnen haben, aber sie besagt nichts gegen die genealogische Methode, als solche, vielmehr fordert sie bloß auf dafür zu sorgen, daß man in diesen Fragen künftig mehr genealogisches Material sammelt und überliefert, da das bis jetzt vorliegende in nötigem Umfang nicht vorliegt; aber mit ähnlichen Schwierigkeiten haben die meisten Wissenschaften, die Statistik, die Hygiene und viele andere zu kämpfen. Hier kommt es nur darauf an zu zeigen, daß die genealogische Prüfung der physischen Kraft des Menschen der einzige Weg sein wird, um bestimmen zu können, ob eine leise Ab- oder Zunahme vorzukommen pflegt. Merkwürdigerweise liegt heute schon etwas mehr Material zur Beurtheilung der moralischen Fortschrittsfragen vor. Die Statistik, die sich glücklicherweise vermöge ihrer Ouellen ganz bestimmt an die Beachtung der nächsten Generationen zu halten genötigt war, hat in Bezug auf die negative Seite der moralischen Eigenschaften ganz zahlreiche Beobachtungen anzustellen begonnen, wobei häufig die Frage der Vererbung nicht unbeachtet blieb. Es muß aber zugestanden werden, daß auch hier aus geschichtlichen (64 ≡)
Quellen noch vieles nachzuholen sein wird. Indessen ist das Problem des sogenannten moralischen Fortschritts so sehr mit dem gesammten Gesellschaftszustand verknüpft, daß die Aufgabe der Genealogie in dieser Beziehung – da sie sich immer nur an den concreten Einzelfall halten kann – vielfach zurücktreten wird. Die Eigenschaften, die Gegenstand moralischer Bewertung sind, werden, wenn sie collektiv in ihren Wirkungen zusammengefaßt sind, dem Statistiker ein gewisses Bild der Zunahme oder Abnahme darbieten, aber seine Beobachtungen werden individuell genommen, nur dann für den genealogischen Fortschritt in Betracht kommen, wenn er jemals das Verschwinden gewisser Eigenschaften nachweisen könnte. Aber so lange die Qualitäten, mit denen die Moralstatistik zu thun hat, immer dieselben bleiben, kann es wol eine genealogische Vererbungsfrage in Bezug auf die individuellen Fälle, aber keine Fortschrittsfrage im allgemeinen geben, weil die Zunahme und Abnahme des Verbrechens überhaupt nicht den einzelnen charakterisirt, sondern nur den gesellschaftlichen Zustand im ganzen. Es ist daher von verschiedenen Seiten her oft behauptet worden, daß das Moralprinzip an sich eine Veränderung nicht erfahren kann. Auf dem genealogischen Wege können daher wol große Erfahrungen darüber gesammelt werden, in wie weit gewisse auf die Moral bezügliche Eigenschaften erblich seien u. dergl., aber wenn von einem Fortschritt in moralischer Beziehung die Rede sein soll, so kann damit nichts anderes gemeint sein, als daß eine gewisse Art von Tugenden, oder eine gewisse Art von Gebrechen in einer gewissen Classe von Menschen, oder in einer ganzen Nation, oder in einer zufälligen Staatsgemeinschaft häufiger, oder seltener zur Beobachtung gekommen sind. Die Eigenschaften, die hier wirksam waren, dürften wol kaum von jemand in Bezug auf das Individuum in ihrer vollen Unveränderlichkeit verkannt werden können. Denn wenn jemand an Kleptomanie leidet, so kann er zwar nach der Größe des Diebstahls stärker oder schwächer bestraft worden sein, aber wenn man die Fortschrittsfrage der Menschheit nach den Objekten der verbrecherischen Handlungen beurtheilen wollte, so käme man zu den sonderbarsten Schlüssen. Für den Genealogen, der etwa in der Lage war, Kleptomanie in einer Reihe von Abstammungen nachzuweisen, (65 ≡)
wird es ganz gleichgiltig sein, ob der Großvater nur kleine Summen und der Enkel dem heutigen Zustand gemäß eine Million entwendet hat; er wird sich doch dadurch nicht bestimmen lassen von einem moralischen Rückgang oder in einem umgekehrten Fall von einem Fortschritt zu sprechen. Die individuelle Eigenschaft, welche genealogisch in Betracht kommt, ist immer dieselbe, und so lange der Nachweis geliefert werden kann, daß es gute und böse Menschen gegeben, dürfte in der That die Fortschrittsfrage im Gebiete der Moral nur in Rücksicht auf gewisse kollektivistische Wirkungen zu Resultaten führen. Viel schwieriger aber auch lehrreicher gestaltet sich das Problem in Betreff der den Menschen innewohnenden intellektuellen Eigenschaften, in Bezug auf welche ohne Zweifel der Genealogie ein großes Feld, vielleicht der bedeutendste Antheil an seiner Bearbeitung, eröffnet zu sein scheint. Daß dies der Fall ist, haben auch die hervorragendsten Vertreter neuerer psychologischer Wissenschaften vollständig anerkannt. Denn man kann sagen, daß alle Entscheidung der Frage, ob es einen inneren Fortschritt der in der Geschichte wirkenden Individualität gebe oder nicht, von der Beobachtung über die Zunahme des Intellekts in aufeinanderfolgenden Generationen abhängt. Daß die Behauptung als solche oftmals aufgestellt und mit vieler Gelehrsamkeit vertreten worden ist, beweist, daß man den Punkt unzweifelhaft richtig zu bezeichnen gewußt hat, um welchen sich das Fortschrittsproblem überhaupt dreht. Die Schwierigkeit liegt eben nur darin, den empirisch herzustellenden Beweis von der Vermehrung, und man darf gleich hinzufügen von Vermehrbarkeit, Verbesserlichkeit, Erhöhung des Intellekts zu liefern. Es braucht nicht wiederholt zu werden, wie sehr sich die Naturwissenschaften von den äußerlichen Schädelmessungen angefangen bis zu den sorgfältigsten Untersuchungen der Gehirnsubstanz seit lange bemüht haben, um greifbare Beweise für ein Postulat zu erbringen, welches sich aus dem Satze zu ergeben scheint, daß größerer Arbeitsleistung auch eine größere Kraft entsprechen müsse. Indessen vermag sich die Forschung doch nicht bei einer so formalen Entscheidung zu beruhigen, sie wünscht durchaus auch im Einzelnen den Fortschritt in seinen sichtbaren (66 ≡)
Eigenschaften, sei es in realem oder idealem Sinne, nachzuweisen. Die Genealogie wird sich nicht vermessen, hier das letzte Wort sprechen zu wollen, aber wenn sie in dieser Richtung ein schon vielfach vorbereitetes Thatsachenmaterial nach Gesichtspunkten dieser Art geordnet haben wird, wie es keiner anderen Wissenschaft zu Gebote steht, so wird man sich wundern, daß nicht von allen Seiten mehr geschehen ist, um das brach liegende Feld zu bearbeiten. Auf den ersten Blick ist es ja richtig, daß die genealogische Beobachtung wenig Förderung zu geben scheint. Sie zeigt uns Väter von größter Gelehrsamkeit, deren Kinder immer wieder von neuem beginnen müssen, Dichter, welche keine dichterisch veranlagten Söhne haben, freilich auch Maler und Musiker wiederum, die eine ganze Generationenreihe gleicher Talente, eben Maler und Musiker, hervorbringen, – wo ist da der Fortschritt? – im allgemeinen steht es ja fest, daß niemand den Mutterlaut der Sprache mit auf die Welt bringt, daß das deutsche Kind in Frankreich ein Franzose wird und unter den Chinesen bloß chinesisch sprechen lernt. Könnte man vermöge dieser Beispiele, die hundertfältig zu vermehren wären, an der Vererbung des besondern Intellekts überhaupt vielleicht verzweifeln, wie wollte man die um soviel schwierigere Fortschrittsfrage auf diese Art zu lösen sich vermessen? Und doch gibt es Erwägungen, welche den genealogischen Weg der Beobachtung für wichtig genug erscheinen lassen. Man trete zunächst den Erscheinungen der Thierwelt, welche vermöge ihrer einfachen Lebensäußerungen zuverlässigere Schlüsse zuzulassen scheint, etwas näher. Das Pferd, welches im wilden Zustand mit dem Lasso eingefangen und nur durch die schwersten zum Theil grausamsten Zwangsmittel den Zwecken des Menschen dienstbar gemacht werden kann, verändert in der häuslichen Züchtung seine Natur so sehr, daß der Stallmeister die Abkömmlinge guter Reit- und Fahrpferde, sobald sie in dem entsprechenden Alter stehen, durch die einfachsten Erziehungsmittel an den Sattel zu gewöhnen oder an den Wagen zu spannen vermag. Die Züchtung der Jagdhunde besorgt der Jäger mit solcher Vorsicht in der Auswahl der Eltern, daß er sich der Talente seiner Zöglinge versichert weiß, bevor er noch den (67 ≡)
ersten Erziehungsversuch gemacht hat. Alle unsere heutigen Hausthiere lassen im Vergleiche mit den wilden Spielarten derselben Rasse schon von der Geburt an Eigenschaften erkennen, die jenen durchaus mangeln. Schließlich dürfte kaum jemand gegen die Annahme etwas einzuwenden haben, daß die wilde Katze und die Hauskatze, obwol sie derselben Art angehören, eben doch nur ihres gleichen zur Welt bringen. Darin liegt vielleicht für die Frage der Variabilität in Bezug auf Fortschritt mehr Beweiskraft, als in den vielen Fällen, welche durch die Zuchtwahl festgestellt sind. Denn bei dieser handelt es sich um ein durch physische Umstände herbeigeführtes Produkt; bei der Beobachtung des gezähmten Thieres, welches eben nur gezähmte Nachkommenschaft erzielt, liegt dagegen der Fall vor, daß sich Eigenschaften im Wege der Vererbung nachweisen lassen, die im psychischen Sinne unzweifelhaft für erworben gelten können. Und diese Ueberlegung ist deshalb für die Fortschrittsfrage besonders wichtig, weil vom Standpunkt physiologischer Betrachtung der Begriff der erworbenen Eigenschaften weit schwerer zu fassen ist und eine Uebereinstimmnng darüber, was unter einer solchen im physischen Sinne zu verstehen, nicht eigentlich vorhanden zu sein scheint. Ueberhaupt ist ja die Variabilität der sogenannten körperlichen Eigenschaften in der gesammten Lebewelt - ganz abgesehen davon, ob sie einen Fortschritt bezeichnet oder nicht - viel schwerer nachweisbar, als jene erwähnten Aeußerungen der civilisirten Thiere, die wir der Kürze halber psychisch nennen wollen. Das oft citirte Beispiel der sechsfingerigen Hand - wobei es unentschieden bleiben mag, ob es ein Fortschritt heißen müßte, wenn mir 12 Finger hätten - ist jederzeit eine vereinzelte, genealogisch unfruchtbare Erscheinung geblieben. Und wie viele Dinge ähnlicher Art ließen sich bemerken. In den letzten Capiteln dieses Werkes wird gezeigt werden, in welcher Weise man vermittelst der genealogischen Methoden sich der Entscheidung dieser Frage zu nähern vermöchte. Betritt man das Gebiet menschlicher Empfindungsvererbungen, so scheint die Geschichte der Musik eines der vorzüglichsten Capitel in Betreff der fortschreitenden Eigenschaften bilden zu können. Denn wenn die Aeußerungen der schönen Künste, welche dem Wesen (68 ≡)
der menschlichen Natur entspringen, vermöge der unmittelbaren Betheiligung der Sinnesorgane an den Hervorbringungen des Malers, des Bildners, des Tondichters überhaupt geeignete Objekte der Untersuchungen über psychische Vererbung sein dürften, so sind die in der Musik unzweifelhaft hervortretenden „Compositionstechnischen“ Fortschritte noch besonders geeignet Rückschlüsse auf die inneren Veränderungen der musikalischen Empfindungsorgane zu gestatten. Man weiß, daß die heute lebenden Kulturvölker noch vor verhältnismäßig ganz kurzer Zeit nur homophone Musik gekannt haben; die allmähliche Entwicklung, in welcher die Harmonie mehr und mehr dem menschlichen Ohr als wolthuende Wirkung akustischer Vorgänge erschien, ließe sich als eine historische nach allen Seiten hin genau bestimmen, wenn man die Generationen rückwärts zählen wollte, die unter dem Einfluß der Accorde ihre Nerventhätigkeit entwickelt haben. Wahrscheinlich handelt es sich um nicht mehr als zwei oder dritthalb Dutzend Vorväter Richard Wagners, welche sich allmählich von dem Wolgefallen des Einklangs zu der Polyphonie seines Parsifal hindurchgerungen und emporgehoben haben. Ob der musikalische Abt Hermann von Reichenau toll geworden wäre, wenn man ihn unmittelbar aus seinem Grabe in das Bayreuther Parterre hätte setzen können, läßt sich nicht sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich, daß er die Tonwirkung der polyphonen Musik für nichts anderes, als ein Nebeneinanderlaufen von Tonreihen dreier, vier oder mehrerer Personen und Instrumente empfunden haben würde, wie wir etwa nach verschiedenen Seiten hinhören, wenn gleichzeitig drei oder vier Musikchöre aus der Ferne schallen. Erwägt man die verschiedenen Resultate, welche die neuere Tonpsychologie durch Experimente mit gleichzeitig lebenden Menschen zu Tage gefördert hat, so kann historisch-genealogisch betrachtet wol kaum ein ernster Zweifel bestehen, daß unser zwölfter Großvater musikalisch anders organisirt war, als der Besucher des Bayreuther Theaters. Worin diese Variabilität bestand oder vielmehr bestehen konnte und als denkbar sich zeigen dürfte, läßt sich ja bekanntlich durch kein Experiment feststellen, und es ist dies freilich überhaupt der Mangel aller historischen Erfahrung, allein die vordringende Kenntnis der Vorgänge des menschlichen Organismus kann es möglicherweise (69 ≡)
dahin bringen, die qualitative Veränderbarkeit – die Abänderungsfähigkeit gerade jener Organe aufzuzeigen, die beim musikalischen Empfinden hauptsächlich betheiligt sind. Die Genealogie muß, kann und wird hier dem forschenden Physiologen oder Psychologen sicherlich unter die Arme greifen, um das Fortschrittsräthsel zu lösen. Ist nun darüber kein Zweifel, daß der Fortschritt der Musik in der polyphonen Ausgestaltung gleichzeitiger Tonwirkungen lag, so muß dieser äußeren Thatsache eines Fortschritts der „Technik“ allerdings auch eine fortschreitende Variabilität der vererbten Eigenschaften entsprechen. Die Schwierigkeit liegt fürs erste wahrscheinlich nur darin, daß zunächst in der äußeren Einrichtung des das musikalische Empfinden bedingenden Organs physiologisch betrachtet im Laufe geschichtlicher Zeiten gewiß keinerlei Veränderung erkennbar war; vielmehr weist alles, was man vom menschlichen Ohr durch Darstellungen und Abbildungen wie durch Beschreibungen seit tausend Jahren erfahren hat, auf eine völlige Unveränderlichkeit hin. Wenn also dennoch dem heutigen Menschen in der Polyphonie der Musik angenehme Empfindungen erregt sind, die den früheren Geschlechtern mindestens unbekannt waren, wahrscheinlich unangenehm gewesen wären, so stellt sich die Annahme von einer stattgefundenen Veränderung der neuerdings angeborenen Eigenschaften doch als ein logisches Postulat dar; und wenn die Beobachtung einer solchen Veränderung an den Organen der musikalischen Empfindung selbst nicht möglich war, so würde man vielleicht auf die älteren psychologischen Anschauungen gestützt sagen dürfen, daß jene Veränderungen, auf denen der Fortschritt der musikalischen Empfindungen beruhte, in den imponderabeln Oualitäten des Menschen gesucht werden könnten, die dem Messer und Mikroskop unerreichbar zu sein scheinen. Wie man auch die colossalen Wirkungen der Polyphonie auf das menschliche Empfindungsvermögen erklären mag, darüber kann kein Zweifel sein, daß der Vererbungsbestand von dem, was man heute im Gegensatze zum homophonen Tonsystem als Musik bezeichnet, ein völlig verschiedener ist. Die erlangte Fähigkeit des Verständnisses der Harmonie setzt unbedingt eine angeborene Variabilität der Eigenschaften voraus, welche bei den Tonempfindungen (70 ≡)
maßgebend sind. Und damit ist ein Beispiel gegeben, daß den in den äußern Erscheinungen als technisch zu bezeichnenden Fortschritten auch ein die inneren Qualitäten betreffende Veränderung entspreche. Würde bei der genealogischen Betrachtung sich nun ein Beweis führen lassen, daß dieser innerliche Fortschritt in Geschlechtsreihen zur Erscheinung kommt, so wäre ein wesentliches Moment in der Frage des historischen Fortschritts gegeben. Freilich würde die Genealogie damit noch immer nicht den Schluß zu ziehen gestatten, daß ein solches Fortschreiten etwas indeterminirtes sei, vielmehr ist es wahrscheinlich, daß die Veränderlichkeiten nur innerhalb gewisser Grenzen stattgefunden haben, und daß diese ebensogut in anderen Generationsreihen zu einem Rückschreiten führen könne, wie sie zunächst einen musikalischen Fortschritt zu erweisen schienen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß man auf dem Gebiete der Malerei bei Erscheinungen der Farbenwirkung gcnerationsweise Variabilität der Vererbung ebenfalls wahrnehmen könnte. Wie immer aber auch das Problem des qualitativen Fortschritts in der Geschichte gelöst werden mag, gegen einen Irrthum kann ganz sicher nur die Genealogie sicheren Schutz gewähren: gegen die Vorstellung von sogenannten Forschrittseinwirkungen, die sich aus der abstracten Theorie von allen in der Weltgeschichte vorgekommenen, oder nachgewiesenen, in Zeit und Ort verschiedenen Entwicklungen technischer Leistungen zu ergeben schienen. Ein Fortschritt dessen subjektive Rückwirkung überhaupt nicht als Vererbungsprinzip begriffen und durch Zeugung und Abstammung erwiesen werden kann, darf überhaupt kein Gegenstand einer Entwicklungslehre sein. Hier wird das genealogische Studium jederzeit eine Controlle für voreilige Schlüsse, oder allzukühne Vermutungen sein. Ganz besonders bedenklich und beschwerlich wird es für den Genealogen bleiben die Forschrittsfrage auch auf dem Gebiete des menschlichen Intellekts zu verfolgen, wo es sich um einen erhöhten Grad von Denkoperationen oder um eine tiefere Einsicht in die gemachten Erfahrungen einer Gesammtheit von untereinander durch Zeugung und Abstammung zusammenhängender Individualitäten handelt. Daß hier die Erblichkeit eine Rolle spiele, ist eine der am meisten umstrittenen Fragen und doch darf (71 ≡)
behauptet werden, daß alle Fortschrittstheorien als gescheitert zu betrachten sein werden, wenn nicht im Intellekt der auf einanderfolgenden Geschlechter Vervollkommnungen angeboren sein sollten, die den staunenswürdigen objektiven Leistungen des modernen geistigen Lebens entsprechen. Sind wir darauf angewiesen den Fortschritt der Wissenschaften nur in der Vermehrung der Bibliotheken, in der Verbesserung der Mikroskope, in der Entdeckung immer neuer Reagentien zu erblicken, oder entspricht diesen technischen Entwicklungen auch ein von Geschlecht zu Geschlecht vererbter Fortschritt des geistigen Vermögens? Die Genealogie steht hier bekanntlich in einem Kampfe mit der Pädagogik und Methodologie der Wissenschaften selbst. Daß von dem genealogischen Prinzip ganz abgesehen werden könnte, scheint indessen doch auch die optimistischste Erziehungskunst nicht zu behaupten und kaum jemand wird der Meinung sein, daß man in den Schulen Afrikas dieselben Resultate erzielen könnte, wie in denen von Europa. Es handelt sich daher auch nicht darum, die Frage selbst zu lösen, sondern lediglich um den Antheil, der der Erblichkeit des geistigen Vermögens an den Resultaten der Erziehung zugesprochen werden darf. Für die Feststellung der genealogischen Aufgaben genügt es. wenn die Möglichkeit des Fortschritts im Intellekt nicht ausgeschlossen ist; und daß dies wirklich nicht der Fall, darüber mögen einige Erwägungen zum Schlusse wol am Platze sein. Jedermann weiß, daß alle erworbenen Kenntnisse der Väter den Söhnen verloren gehen; von den Sprachen, die jene sprachen, von den Naturgesetzen, die sie beherrschten, von dem ganzen Erfahrungskreis, der ihnen zu Gebote stand, ist nichts auf diese übergegangen, selbst das Einmaleins müssen die Kinder immer von neuem wieder lernen. Wenn also durch unzählige Beispiele, von denen in den späteren Capiteln dieses Buches zu sprechen sein wird, dennoch nachgewiesen ist. daß Vererbungen geistiger Qualitäten stattfinden, so ist es klar, daß es sich nicht um eine materielle Uebertragung von irgendwelchen erworbenen Fähigkeiten, Vermögen oder Kräften gehandelt haben könne, sondern um eine Eigenschaft, welche dem Kinde möglich macht, das von den Eltern erworbene (72 ≡)
ebenfalls zu erwerben und zwar in einer graduell und virtuell erhöhten Weise. Das Fortschrittsmoment kann nur darin gesucht werden, daß die von den Eltern schon erworbenen Fähigkeiten von den Kindern vermöge der ererbten Anlage dazu so nutzbar geworden sind, daß eine Erhöhung der Leistungen in jeder nächsten Generation ermöglicht worden ist. Das subjektive Fortschrittsprinzip des Intellekts stellt sich aber bei dieser Betrachtung in wesentlicher Analogie zu den vervollkommten Tonempfindungen der späteren Geschlechter, als eine erhöhte Disposition dar, den intellektuellen Productionen nachzukommen. Man sage nicht, daß mit dieser Ueberlegung nicht viel gewonnen wäre, wenigstens auch von medizinischen Autoritäten wird es ja zuweilen anerkannt, daß die Wissenschaft der Pathologie trotz aller bewunderungswürdigsten Forschungen über die Ursachen der Krankheiten nicht ohne die Annahme von Dispositionen auszukommen vermöchte. Wenn es den genealogischen Studien gelänge durch methodische Entwicklung dieser Wissenschaft zu zeigen, daß sich von Geschlecht zu Geschlecht nicht bloß der Normalbestand des intellektuellen Vermögens, sondern auch jene Variabilitäten zu vererben vermögen, die eine erhöhte geistige Production und eine vermehrte Thätigkeit der die Welt der Begriffe bedingenden physischen und psychischen Organe ermöglichen, so wäre damit allerdings auf empirischem Wege der Beweis hergestellt, daß der von ’’Kant’’ geahnte Fortschritt im Sinne der Auswicklung der menschlichen Fähigkeiten thatsächlich vorhanden sei. Freilich würde aber die Einschränkung gemacht werden müssen, daß dieser Fortschritt außerhalb jener Abstammungsreihen, die auf Zeugung und Vererbung beruhen, keineswegs gedacht werden könnte. Eine in weltbürgerlicher Absicht gedachte bloße Form äußerer Zustände könnte diese Auswicklung beziehungsweise diesen Fortschritt unmöglich hervorbringen, solange nicht Rückwirkungen auf das Subjekt in den veränderten Eigenschaften der Vererbung auch genealogisch zum Ausdruck gekommen sind. Der naturwissenschaftlichen Forschung wird es vorbehalten sein die sichtbaren Merkmale solcher Veränderungen in der Aufeinanderfolge der Geschlechter zu entdecken, die Genealogie wird sich immer darauf (73 ≡)
beschränken Thatsachen zu bezeichnen, die das subjektive Fortschrittsmoment in der Zeugung und Abstammung, d. h. eine höher entwickelte Befähigung, eine fortschreitende Disposition als etwas wahrscheinliches – wenn man will als ein logisches Postulat erkennen lassen. Sie liefert damit die allerwichtigsten Beiträge zur Frage des historischen Fortschritts, aber sie sichert zugleich auch vor jeder falschen Schlußfolgerung, welche in einer Anwendung des Begriffs des Fortschritts auf die dunkle Abstraction der sogenannten „Menschheit“ gesucht zu werden pflegt, indem sie keinen Augenblick von den Nachweisungen der Zeugung und Abstammung im einzelnen und besonderen abzusehen vermag.
Schlußbetrachtung.So vielfältig sind die Bande, welche die Genealogie mit dem größten Theile aller historischen und naturwissenschaftlichen Gebiete verknüpft, daß man die Erwartung aussprechen dürfte, sie werde sich in naher Zeit außerordentlich entwickeln und erweitern. Im Sinne einer Hilfswissenschaft gefaßt, wird sie kaum länger als ein bloßes Anhängsel politischer oder sozialer Geschichte gedacht werden können, sie wird vielmehr von denjenigen Wissenszweigen mehr und mehr herangezogen werden müssen, welche kurzweg in dem Begriffe der Biologie sich zu einer gewissen Einheit zu gestalten scheinen. Wer den Gang des modernen Wissensbetriebes unbefangen bedenkt, wird zugleich in den aufgedeckten Beziehungen eines Gebietes, welches zuweilen nur als eine Antiquität aus überwundenen Zeitläuften, als ein Ueberbleibsel feudaler Vorstellungen angesehen worden ist, die beste Gewähr seines Aufblühens erkennen, und man kann nicht zweifeln, daß die zahlreichen Interessen und die reichen Mittel, welche sich allen naturwissenschaftlichen Disziplinen zuwenden, früher oder später auch der Genealogie zu gute kommen werden. Das Material, welches diese Wissenschaft zu bewältigen hat, ist ein ungeheuer ausgedehntes und welche Masse von Beobachtungen aus den aufgespeicherten Schätzen genealogischer Ueberlieferungen zu gewinnen sein wird, ist heute nur erst zu ahnen. (74 ≡)
Um dieses Meer von erkennbaren Thatsachen aber mit Nutzen auszuschöpfen, dazu dürfte viel gemeinsame Arbeit nötig sein, bei der es darauf ankommen wird, daß sich die Vertreter der verschiedensten Disziplinen mit aller Strenge nur jener Methoden bedienen, welche aus der Natur des Gegenstandes selbst hervorgegangen sind. Dazu sollte der Inhalt der folgenden Capitel dienen und helfen.
(75 ≡)
Erster Theil.
Die Lehre vom Stammbaum.
(76 ≡)
(77 ≡)
Erstes Capitel.
Genealogische Grundformen.Alle genealogische Forschung beruht auf einer doppelten, sehr verschiedenartigen Betrachtung von Zeugungs- und Abstammungsverhältnissen. Wenn man eine bestimmte Persönlichkeit in die Mitte einer Reihe von Geschlechtern gestellt denkt, so lassen sich Beziehungen derselben entweder zu vorhergehenden oder zu nachfolgenden Generationen erkennen und darstellen. Indem man nun die innerhalb eines bestimmten Zeitraums vorsichgegangenen Zeugungen und Abstammungen verfolgt, die das Leben dieses Individuums bedingten und hervorbrachten, oder aber von diesem selbst ihren Ursprung und Ausgangspunkt genommen haben, ergibt sich eine vollständig verschiedene Ausfassung und Ansicht von dem genealogischen Problem. Im erstern Falle werden aus den in der Zeit vorhergegangenen Geschlechtern diejenigen Elternpaare zur Beobachtung kommen, die in stets sich verdoppelnder Art die Abstammung eines Individuums bewirkten, während im andern Falle die von einem Elternpaare ausgegangenen Zeugungen in absteigenden Linien an den sich vermehrenden Nachkommen verfolgt und nachgewiesen werden. Die Genealogie berücksichtigt mithin in besonderen Aufgaben Vorfahren, deren Zeugungen zusammengenommen das Dasein eines Individuums bestimmen, und Nachkommenschaft, die in ihrem Dasein von den Zeugungen eines Individuums bedingt war. Diese beiden Betrachtungsarten des genealogischen Stoffes sind etwas grundverschiedenes. Von dem deutlich erkannten Bilde ihres ganz verschiedenen Characters hängt alles richtige genealogische Verständnis und Denken ab. (78 ≡)
In darstellender Form wird jene Betrachtungsweise, welche von dem Individuum aufwärts steigend die sich verdoppelnden Elternpaare aufsucht, die „Ahnentafel“ genannt, während die Nachweisung der von einem Elternpaare abstammenden Nachkommenschaft den Namen der „Stammtafel“ trägt. Jede Verwechslung beider Begriffe, oder auch nur der Bezeichnung derselben , erschwert das richtige genealogische Verständnis und gibt Anlaß zu ganz falschen Folgerungen und Irrthümern aller Art. Der Begriff der Stammtafel umfaßt nur solche Darstellungen von Blutsverwandtschaften, die sich im Kreise der Descendenten d. h. jener Geschlechtsreihen bewegen, die vom Elternpaare ausgehen, die abstammenden Kinder aufzeichnen und diese immer wieder in ihren elterlichen Eigenschaften als Väter oder Mütter neuer Geschlechtsreihen betrachten. Auch die Bezeichnung „Stammbaum“ gebührt eigentlich durchaus nur dieser Art genealogischer Vorstellung, doch ist der Gebrauch dieses Wortes ein so vielfältiger, daß die erwünschte Einschränkung des Ausdrucks auf den bezeichneten Begriff der Stammtafel wol nicht leicht zu erreichen sein mag. Im Gegensatze zur Stammtafel stellt sich der Begriff der Ahnentafel als die Darstellung der Ascendenten dar, d. h. der Väter und Mütter eines oder mehrerer durch geschwisterliche Bande verbundener Individuen, und zwar in der Weise, daß die Eltern des Elternpaares, und immer wieder in aufsteigenden Linien deren Väter und Mütter zur Kenntnis gebracht werden. Wenn man zur Unterscheidung dieser beiden Grundformen aller genealogischen Wissenschaft die Bezeichnung Stammtafel und Ahnentafel gewählt hat, so ist zwar nicht zu läugnen, daß der gewöhnliche Sprachgebrauch in der Anwendung dieser Worte wenig genau und streng zu sein pflegt[1] und daß auch in älteren Zeiten (79 ≡)
bei der Bezeichnung genealogischer Verhältnisse viel willkürliches und unklares ausgesprochen wurde, allein in der Sache waren sich alle, die sich wissenschaftlich mit genealogischen Dingen beschäftigten, doch stets sehr klar über die Grundverschiedenheit der Betrachtungsweise, die einerseits der Ahnentafel und andererseits dein Stammbaum zukommt. Bei den alten Völkern erscheint die Stammtafel, wie die Ahnentafel zunächst in einer so vereinfachten Form, daß für diese von den genealogischen Systematikern der Name der „Stammlisten“ angewendet wird, doch ist es klar, daß auch die ältesten Nachrichten bei den verschiedensten Culturvölkern im vollen Bewußtsein des sachlichen Unterschiedes der beiden Grundformen genealogischer Betrachtung verfaßt sind. Wenn man von einem Stammbaum Jesu sprach und diese Bezeichnung in jedem Schulbuche leider fortführt, so versteht man selbstverständlich die Ahnentafel Marias darunter, und niemand läßt sich durch den wissenschaftlich unstatthaften Ausdruck in der Ueberzeugung beirren, daß Jesus keine Nachkommen hatte. Will man jedoch Sorge tragen, daß die genealogische Terminologie nicht zu unheilvollen Irrungen Anlaß gebe, so ist wissenschaftlich zu fordern, daß die Begriffe scharf getrennt werden und daß alle Darstellungsformen, die sich im Kreise der Descendenz bewegen, ausschließlich mit der Bezeichnung von Stammbäumen wie jene, die sich auf die Ascendenten (80 ≡)
beziehen, lediglich mit der von Ahnentafeln belegt werden. Was aber nebenher mit dem Ausdruck „Stammlisten" bezeichnet werden sollte, stellt sich unter dem Gesichtspunkte wissenschaftlicher Terminologie nur als eine Vereinfachung des Begriffs von Stammtafel und Ahnentafel dar. indem man unvollständige, und beziehungsweise nur aus väterliche Ahnen oder Nachkommen beschränkte Verzeichnisse der Kürze wegen mit dem Namen von Stammlisten ganz passend bezeichnen kann. Hält man indessen an den beiden wissenschaftlichen Grundformen aller genealogischen Darstellungen prinzipiell fest, so wird man die Beobachtung machen können, daß im Laufe der Geschichte allerdings den beiden Betrachtungsarten von Geschlechtsreihen oder Generationen eine sehr verschiedene Werthschätzung zu theil geworden ist, und es ist sehr merkwürdig, wie spät die Ahnentafel im strengen Sinne des Wortes sich Geltung verschaffte, obwohl die Ahnenverehrung mit Recht als eine der vorzüglichsten Quellen der Genealogie, oder wenigstens des genealogischen Interesses bezeichnet zu werden pflegt. Wenn aber die Geschichtserzähler an die Darstellung der auf die Geschlechtsreihen bezüglichen Ereignisse schritten, so zogen sie sofort die Form des Stammbaums derjenigen der Ahnentafel vor und erzählten in activischen Sätzen: Abraham zeugte den Isaak u. s. w. Auch die Griechen kannten in ihren Theogonieen nur den Stammbaum als Grundform ihrer Darstellungen. Schließlich führte die Vorstellung von den Stammvätern und ihrer Wichtigkeit für die ganze Nachkommenschaft in der Familie und selbst im Stamm und ganzem Volk zu einer lediglich den Stammbaum beachtenden Genealogie. Die Ahnentafel feierte unter ganz andern Einflüssen erst wiederum eine Art von Auferstehung in andersgearteten Culturen. Psychologisch ließe sich für die Bevorzugung des Stammbaums manches merkwürdige bemerken. Verehrung, selbst religiöser Cultus. wendet sich den Ahnen zu; die ungeheure Kraft der Liebe nimmt ihre Richtung nach dem Stammbaum. Großeltern und vollends Urgroßeltern werden vom Zeitenstrome hinweggeschwemmt und verschwinden dem Gedächtnisse der Nachlebenden, aber auf Enkel und Enkelkinder, den Erben der erstrebten und gewonnenen (81 ≡)
Güter, blicken die Stammväter mit Stolz und Freude herab. So verwittern an Gräbern die guten Worte der Erinnerung auf den Gedenksteinen der Ahnen, die bald nur noch der Geschichtsforscher aufsucht, aber in lebendiger Hoffnung blickt die Selbstliebe der Eltern auf den Fortgang der Generationen. Auch der rückwärts gekehrte Blick scheint nur dann ganz gefesselt werden zu können, wenn sich die Erzählung vergangener Thaten von dem Stammvater in absteigender Linie zu Kind und Kindeskindern hinbewegt. eine Erzählung, die sich zu den Ahnen stufenweise emporschlingt, erscheint dem an die Stammtafel gewöhnten Auge unnatürlich und fast komisch. Indessen wird man doch nicht behaupten dürfen, daß die Vorliebe für die Stammtafel ausschließlich in den räthselhaften Tiefen des menschlichen Herzens, welches - den Dank gegen vergangene Geschlechter immer noch durch die größere Liebe zu den nachfolgenden übertäubt, ihre Erklärung findet vieles hat zur Bevorzugung des Stammbaums auch die Sitte und das Recht vergangener Zeiten beigetragen, in denen noch alles von den Stammeshäuptern abhing, und außerdem die Frau neben dem Stammvater nur eine sehr unbedeutende Stellung einnahm. Es war daher selbstverständlich, daß die Stammlisten immer nur auf die männliche Ascendenz zu achten brauchten und somit die Ahnentafel mit der Berücksichtigung von Vätern und Müttern rechtlich und gesellschaftlich mehr oder weniger gegenstandslos wurde. Als sehr merkwürdig erscheint es, daß man in der indogermanischen Urzeit für die Eltern der Frau überhaupt keine Bezeichnung kannte und daß man daher mit Recht den Schluß ziehen konnte, die Brauteltern wären nicht wie die Mitglieder des Gattenhauses zur Verwandtschaft im engeren Sinne gerechnet worden. Daraus ergibt sich dann weiter, daß die mütterlichen Ahnen ursprünglich eine untergeordnete Bedeutung hatten und erst im Laufe der Zeiten eine gleichberechtigtere Stellung erwarben, womit die Erscheinung erklärt sein würde, daß die Genealogien der alten Völker in der Ascendenz immer nur die väterliche Reihe berücksichtigten. Bei den alten Indiern zeigt sich auch die verschiedene Werthschätzung der väterlichen und mütterlichen Verwandtschaft (82 ≡)
in den Gebräuchen bei dem Tode von Verwandten des Vaters, Großvaters oder Urgroßvaters, durch welchen die Familie zehn Tage lang unrein wird, während bei dem Tode der nächsten Verwandten der Mutter die Unreinheitsfrist nur drei Tage dauert.[2] In völlig überzeugender Weise hat daher D. Schrader[3] den Satz aufstellen können, daß in der altindogermanischen Familie nur die Verschwägerung der Schwiegertochter mit den Verwandten des Mannes, nicht aber die des Schwiegersohnes mit den Verwandten der Frau zur Anerkennung gekommen sei. Nur das erstere Verhältnis ist in den indogermanischen Sprachgleichungen zum Bewußtsein gebracht und ebenso durfte derselbe hinzufügen, daß damit ein höchst wichtiger Schlüssel für das Verständnis der ältesten Gesellschafts- und Familienverhältnisse gewonnen worden sei. „Wir haben," sagt der gelehrte Verfasser, „von einem Zustand der altindogermanischen Familienorganisation auszugehen, in welchem der Begriff der Verschwägerung lediglich hinsichtlich der Verwandten des Mannes gegenüber der Frau ausgebildet war. Die Sippe der Frau mochte schon damals als eine „befreundete“ gelten, aber als durch Verwandtschaft betrachtete man sich noch nicht mit ihr verbunden. Mit der Ehe trat ein Weib aus dem Kreis ihrer Anverwandten in den des Mannes über, was sie aber mit diesem vereinigte, zerriß zugleich ihre bisherigen Familienbande, knüpfte nicht neue zwischen ihrer und des Mannes Sippe an. Das Weib verschwand, sozusagen, in dem Hause des Ehegatten.“ (83 ≡)
„Im engsten Zusammenhange aber hiemit steht es. wenn, ebenso wenig wie durch die Braut und junge Frau verwandtschaftliche Beziehungen zu den Angehörigen derselben angeknüpft wurden, eine ebenso geringe Beachtung auch die durch das zur Mutter gewordene Weib vermittelte Blutsverwandtschaft zwischen ihren Verwandten und ihren und ihres Mannes Kindern, wenigstens zunächst bei den Indogermanen, fand. Es ist somit nach meiner Auffassung kein Zufall, daß wol des Vaters nicht aber der Mutter Bruder übereinstimmend in den indogermanischen Sprachen benannt ist und überhaupt lediglich cognatische Verwandtschaftsgrade sich durch urzeitliche Gleichungen nicht belegen lassen.“[4] Aus diesem geistigen und gesellschaftlichen Zustand der indogermanischen Vorzeit erklärt es sich vollständig, daß alle sogenannte Ahnenverehrung auch noch in historischen Zeiten ans den männlichen Stammeskreis beschränkt blieb und die natürliche durch das Elternverhältnis gegebene Gabelung des Ascendentenbegriffs kaum beachtet worden ist. Wahrscheinlich ist es ein noch kaum gewürdigtes Verdienst der griechischen Naturphilosophie richtigere Ahnenvorstellungen in die Welt gesetzt zu haben und jedenfalls ist auch in dieser Beziehung Aristoteles derjenige, der das Ahnenproblem zum erstenmale naturgesetzlich durchzudenken unternommen hat. Aber in gesellschaftlicher und familienrechtlicher Beziehung erhielt die mütterliche Ascendenz doch erst durch die Rechtsbildung der Römer wirkliche Berücksichtigung. (84 ≡)
Die Ahnentafel im eigentlichen und vollen Sinne des Wortes hat sich allmählich als ein Bedürfnis der Familiengeschichte entwickelt und ihre formale Vollendung gehört einer Zeit an, in welcher die moderne Gesellschaftsordnung zur vollen Herrschaft gelangt war. Nicht aus dem natürlichen Wunsche die Ahnen in aussteigenden Reihen vorzustellen hat sie sich entwickelt, sondern in Rücksicht auf gewisse Vortheile, welche der Ahnennachweis erbrachte, ist die Notwendigkeit hervorgegangen, die Ascendententafeln im Gegensatz der Descendentenreihen in der Breite der Entwicklung darzustellen, während diese ihren Werth in der Länge der Geschlechtsreihen erblicken mochten. Denn der Stammbaum,. der im Nachweis der immer neu entstandenen Geschlechter nach unten hin den Zeilenstrom erfüllt, strebt lediglich dahin den Stammvater beziehungsweise die Stammeltern fest zu stellen, von welchen eine Familie ausgegangen ist. Er erfüllt seinen Zweck in der Sicherstellung des Verhältnisses von Söhnen und Vätern und darf sich jede Vernachlässigung von Zweigen und Linien gestatten, die etwa auch zu demselben Stamme hinleiten würden; die Ahnentafel dagegen kann von keinem Gliede absehen, welches in das System ihres natürlichen Zusammenhangs gehört, sie ist ein für allemal als ein mathematisches Problem gegeben und bricht im selben Augenblick ab, wo die Ahnenreihe nicht in doppelter Anzahl der vorhergehenden nachgewiesen werden kann. Die Ahnentafel bietet mithin Schwierigkeiten dar, die in gar keinem Verhältnis zu dem Stammbaum stehen und es ist daher auch unter diesem Gesichtspunkt sehr erklärlich, daß sie sich nur unter den Einflüssen der höchsten fortschreitenden Kultur entwickeln konnte. Sie bedarf in viel größerem Maße des Schriftthums als die Stammtafel, weil sich wol im Gedächtnis einer Familie die Reihe der Väter und Söhne, gleichsam als eine Linie vorgestellt, leicht zu erhalten vermag, niemals aber eine Ahnentafel als ein Gegenstand mündlicher Ueberlieferung gedacht werden dürfte. Die Formen, in welchen die Stammtafeln erscheinen, können die mannigfaltigsten sein, es kommt immer nur darauf an, daß eine gewisse, beliebig ausgewählte Reihe von Generationen auf einen Stammvater beziehungsweise auf ein Stammelternpaar zurückgeführt (85 ≡)
ist. Die Ahnentafel dagegen läßt keine Auswahl zu, sie hat ihr ein für allemal gültiges Schema:
Wie man hieraus ersieht, lassen sich die Abzweigungen der von a b abstammenden Generationen immer wieder als besondere Stammbäume behandeln; alsdann erscheint a b als Stammelternpaar einer Anzahl von Linien c, d, e, f, von denen jede für sich betrachtet werden kann. Die einzelnen Linien des Stammbaums weisen in ihrer jedesmaligen Beziehung zu einem Stammelternpaar aus ihren gemeinsamen Ursprung hin und stehen in Folge dessen untereinander in einer Verwandtschaft, deren Grad durch die Beziehungen zu dem Stammvater geregelt ist: Man unterscheidet die Linien einer Familie und die Grade ihrer Verwandtschaft im Hinblick ans eine gemeinsame Abstammung von einem Paare. Alle Descendenzbetrachtungen gehen auf die Vorstellung eines centralen Ausgangspunktes zurück. Im Gegensatze hiezu beziehen sich alle Betrachtungen über die Abstammung eines Individuums auf die Vorstellung unendlicher Reihen von Ahnen, die sich zwar nicht nachweisen aber mathematisch bezeichnen lassen. Für die genealogische Wissenschaft sind beide Arten der Betrachtung die Ahnentafel wie die Stammtafel gleich wichtig und unentbehrlich. Alles richtige genealogische Denken bewegt sich innerhalb dieser beiden Grundformen, welchen jede Zeugungs-, Abstammungs- (86 ≡)
und Verwandtschaftsfrage lebender Wesen angepaßt werden muß.[5] Es eröffnet sich aber, wie sich von selbst versteht, vermöge der mannigfachen Zwecke, die zur Aufstellung von Stammtafeln und Ahnentafeln genötigt haben, die Möglichkeit die Darstellung' derselben sehr verschieden zu gestalten. Dennoch aber werden alle sachlichen Gesichtspunkte, zu deren Erklärung und Beleuchtung genealogische Betrachtungen erfordert sind, immer nur in den beiden maßgebenden Grundformen des genealogischen Denkens erscheinen können. Unter dieser Voraussetzung lassen sich sowol die Ahnentafeln wie die Stammtafeln nach Unterarten gliedern, deren Werth und Bedeutung sachlich zu beurtheilen bleibt und deren Inhalt in dem materiellen Theile der Genealogie des näheren besprochen werden muß. Hier sei nur, soweit die formale Seite der Sache berührt wird, auf einiges aufmerksam gemacht. Die als Unterabtheilung der Ahnentafeln sich darstellenden Ahnenproben haben vermöge der damit verbundenen Zwecke ihre bestimmte durch den Zeitgeschmack wie durch Gewohnheiten und gesetzliche Bestimmungen vorgezeichneten Formularien. Dagegen läßt sich in Bezug auf die Stammtafeln vermöge der engen Beziehungen, die zwischen diesen und den historischen Entwicklungen staatlicher, gesellschaftlicher, cultureller und selbst litterarischer Verhältnisse ausgefunden werden können, eine sehr große Zahl von Unterarten denken, die den Stammbäumen zu Theil werden können. Es sei hier nur im Gebiete der politischen Geschichte auf einige schon von älteren Genealogen hervorgehobenen Darstellungsarten hingewiesen. So unterscheidet Gatterer: Regierungsfolgetafeln, Erbfolgestreitstafeln, synchronistische Stammtafeln neben historischen Stammtafeln überhaupt, und er thut sich etwas darauf zu gute
(87 ≡)
auch noch auf eine seinerzeit neue Art von Tafeln hingewiesen zu haben, die er die Ländervereinigungs- und Trennungstafeln nennt. Man könnte dergleichen historische Darstellungen, für welche die Stammtafelform, das genealogische Bild, maßgebend ist, noch mannigfaltig vermehren, man darf nur nicht verkennen, daß hierbei die Grundform, in welcher sich dem Auge geistig und körperlich der Gegenstand einer Entwicklung einprägt, ausschließlich im Stammbaum dargeboten wird. Wenn es jemandem gelingt culturelle, litterarische oder wissenschaftliche Zusammenhänge generationsweise vorzustellen, so hindert ihn nichts in diesen Fällen einen Stammbaum zu entwerfen, er muß sich nur gegenwärtig halten, daß es sich dabei um ein Gleichnis handelt und diese Form des Darstellens und Vorstellens von der Genealogie nur entlehnt ist, während es sich bei dieser um wirklich vor sich gegangene Zeugungen und Hervorbringung lebender organischer und im engeren und eigentlichen Sinne um menschliche Wesen handelt. Allein die Form des Stammbaums ist für jede Art der Entwicklungsidee etwas so einschmeichelndes und brauchbares, daß dem künstlerischen Erfinden in dieser Beziehung keine Schranken gesetzt sein können, [6] und die Stammtafel daher in ihrer formalen Erscheinung in unendlicher Mannigfaltigkeit gedacht werden kann, wie sie sich auch thatsächlich und geschichtlich in verschiedenster Art und Weise ausbildete.
(88 ≡)
Zweites Capitel.
Die Stammtafel in formaler Beziehung.Wer eine der schön und kunstvoll gezeichneten, oder gemalten Stammtafeln betrachtet, auf welcher die Namen der Abkömmlinge eines Ehepaares auf zierlich stilisirten Blättern verzeichnet sind, die von den Aesten und Zweigen eines Baumes herabhängen, dessen Stamm in gerade aufsteigender kräftiger Gestalt die Stammhalter der Familie darstellt, scheint nicht zweifeln zu können, daß dieses Bild natürlichen Wachsthums sich dem menschlichen Bewußtsein gleichsam von selbst und seit unvordenklichen Zeiten mit innerer Notwendigkeit aufgedrängt habe. So nahe liegt der Vergleich zwischen der in der freien Natur sich entwickelnden Pflanze und der von Geschlecht zu Geschlecht sich fortpflanzenden Familie. Auch wol die in den verschiedensten Sprachen üblichen Wörter zur Bezeichnung des Familienzusammenhangs und der Stammesverzweigung könnten darnach als außerordentlich alt angesehen werden. Indessen scheint im lateinischen das Wort arbor in Anwendung und Verbindung von Verwandtschaftsverhältnissen ziemlich späten Ursprungs zu sein [7] und stemma bezeichnete den Kranz, mit welchem die Ahnenbilder
(89 ≡)
der Römer geschmückt zu werden pflegten.[8] Im deutschen wird Abstamm und Abstammung zunächst ganz allgemein auf den Ursprung bezogen und wol erst in engerer Beziehung mit der Nachkommenschaft (proles) in Verbindung gedacht. Der Name Stammbaum ist dann offenbar dem lateinischen Arbor consanguinitatis oder affinitatis nachgebildet worden, so gut wie arbre généalogique und albero genealogico. Der Schwerpunkt ist ohne Zweifel in Betreff des Aufkommens des Ausdrucks Arborfür Darstellungen von Verwandtschaften in der lateinischen Sprache zu suchen, wie auch sachlich betrachtet eine besondere Aufmerksamkeit auf Familien und Verwandschaftsverhältnisse bei den Römern, wie bei keinem andern Volke des Alterthums beobachtet werden kann. Wenn sich nun aber schon nach der Wortgeschichte der Begriff des Stammbaums keineswegs als etwas so ganz ursprüngliches vermuthen läßt, so muß man doch auch bemerken, daß das Gleichnis vom Baum und der Familienverzweigung eigentlich nicht nach jeder Richtung hin zutreffend ist. Eine gewaltige Eiche als Bild eines großen, weit verzweigten Geschlechts ist sicher eine die Phantasie des Künstlers anregende Idee. Der gewaltige Stamm, der sich aus den weithin fassenden Wurzeln der Stammeltern erhebt, entwickelt seine Aeste und Zweige, welche die Linien und Grade der Familienverwandtschaft passend zu versinnbildlichen scheinen, und dennoch erhält die genealogische Entwicklung durch die Form des Baumes für denjenigen etwas befremdendes, der sich erinnert, daß die in Wahrheit absteigenden Linien der Geschlechter, dem Baumwuchs folgend, für das Auge des Beschauers in aufsteigenden Linien sich bewegen. Selbst in den Zeiten phantasievollster Zeichenkunst hat man die Uebelstände der Darstellungen des Stammbaums als eine Umkehrung des natürlichen Verhältnisses richtig bemerkt und die nach unten gerichtete Descendententafel (90 ≡)
einen umgekehrten Baum genannt.[9] Niemand könnte verkennen, daß die an der Wurzel eines den natürlichen Baum nachahmenden Familienschemas sitzenden Stammeltern in der genealogischen Vorstellung nothwendig den obersten Platz beanspruchen, der ihnen denn auch in vielen rein tabellarischen Darstellungen stets eingeräumt wurde. Das Bild des Baumes enthält einen gewissen Widerspruch in sich selbst und es ist daher sehr verständlich, daß die allerältesten Darstellungen verwandtschaftlicher Beziehungen, die wir besitzen, sich in Formen bewegen, die nicht das mindeste mit dem Gleichnis vom Baume zu thun haben. Was überhaupt zu stammtafelartigen Darstellungen geführt hat, war zunächst nicht eigentlich das genealogische Interesse an sich und auch nicht die Kenntnisnahme von persönlichen Familienverhältnissen und Beziehungen. Vielmehr hat sich in gewissen Kreisen römischer Beamten und Richter lediglich das Bedürfnis ergeben, die aus praktischen Gründen denselben zur Beurtheilung vorliegenden Verwandtschaftsgrade nach gleichen Grundsätzen und Regeln zu behandeln. Der nothwendige Besitz eines Verwandtschaftsformulars in zahlreichen Fällen von Verwaltungsangelegenheiten und privatrechtlichen Fragen hat bei den Römern den Anlaß zu gewissen Aufstellungen, Verzeichnissen und Darstellungen gegeben, aus denen nachher der Stammbaum entstanden ist. Hier läßt sich mithin eine manchen vielleicht unerwartete iconographische Entwicklung beobachten, die tief in die Kaiserzeit, vielleicht in die der Republik zurückgreift. Dem römischen Censor und Richter, welcher erbrechtliche oder verwaltungsrechtliche Fragen zu entscheiden hatte, war die Aufgabe gestellt, nach einer ein für allemal giltigen Regel die Verwandtschaftsansprüche zu beurtheilen, welche irgend eine Person vermöge ihrer Stellung zu einem etwa als Erblasser erscheinenden Mitglieds einer Familie erheben konnte. Zu diesem Zwecke bediente er sich eines Schemas, nach welchem der Grad der Verwandtschaft rasch und
(91 ≡)
ohne Widerrede nachgezählt werden konnte. Es findet sich nun in zahlreichen Rechtshandschriften ein solches Schema bereits aus der Zeit vor Geltung des mütterlichen Erbrechts, welches aber auch noch in spätern Handschrift des Mittelalters nachgezeichnet worden ist, ohne daß man sich des Ursprungs und hohen Alters desselben bewußt geblieben wäre.[10] Dieses Schema war durchaus architektonisch gedacht und ausgeführt worden, und bildete einen Säulenbau, ans dessen unteren Theilen die Verwandtschaft der absteigenden Grade auf Täfelchen verzeichnet wurde. Die vom Vater ausgehenden aufsteigenden Verwandtschaftsgrade bildeten einen Aufsatz, der aber nur einer halben Pyramide glich, weil dabei die mütterlichen Ahnen und auch die Mutter selbst nicht berücksichtigt worden ist, während der Vater und dessen männliche Verwandte nur die Hälfte des Sockels ausfüllten. Diese stammbaumartige Darstellung muß, wie sich keinen Augenblick zweifeln läßt, in einer Zeit verfaßt sein, wo die Mutter und ihre Verwandten noch keinen Erbanspruch erheben konnten. Dies aber war bis zu dem S. C. Tertullianum der Fall, welches unter Hadrian das Erbrecht der Mutter feststellte. Offenbar späterer Zeit verdankt ein anderes Formular seine Entstehung, das eine noch sonderbarere Figur zeigt. Es war aus dem Bedürfnis hervorgegangen die Gleichartigkeil der aufsteigenden, wie der absteigenden Verwandtschaften durch eine möglichst deutlich erkennbare Bezeichnung desselben ihnen anhaftenden Grades zur Anschauung zu bringen; alle Verwandte des gleichen Grades, sowol Vorfahren wie Nachkommen, sollten in diesem Schema immer auf eine Linie zu stehen kommen, und es bildete sich auf diese Weise die Form eines stumpfen Kegels, der den Vater, die Mutter, den Sohn und die Tochter auf der obersten Linie als ersten Verwandtschaftsgrad (92 ≡)
erkennbar machte, während die Basis des Kegels die breiter gewordene Ahnenschaft von Vater und Mutter und die ebenfalls verzweigte Nachkommenschaft von Sohn und Tochter bis zum sechsten Grade der Verwandtschaft zur Darstellung brachte.[11] Es braucht nach dem schon früher gesagten kaum bemerkt zu werden, daß die hier berücksichtigte Erbfähigkeit der mütterlichen Vorfahren ausreichenden Beweis dafür gibt, daß das Schema ans der Zeit nach Hadrian stammt; eine Randbemerkung, die sich am Fuße des dritten Verwandtschaftsgrades findet, verräth uns aber noch deutlicher den Zweck und wol auch die Entstehungszeit desselben. Indem nämlich die Tafel versichert, daß die ersten Verwandtschaftsgrade nach dem Gesetz für steuerfrei anzusehen seien, so weist sie auf eine Epoche hin, in welcher diese Begünstigung, die ursprünglich nur der erste Grad genoß, bereits ausgedehnt wurde, was zuerst von Trajan geschah. Das Schema erweist sich also als eine Arbeit der letzten Jahre des zweiten Jahrhunderts und rührt wahrscheinlich von einem Steuerbeamten her. Man hätte kaum zu ahnen vermocht, das; dieses so gestaltete Schema jemals zu den Formen eines Baumes überzugehen, oder auch nur an einen solchen zu erinnern vermocht hätte. Wenn man aber die Voraussetzung machen darf, daß die in späteren Handschriften massenhaft auftretenden schematischen Darstellungen doch meist auf viel ältere Quellen zurückgehen, da sie sonst nicht in den verschiedensten Gegenden und Ländern immer wieder in denselben Formen vorkämen, so kann man nicht zweifelhaft sein, daß der erfindungsreiche Geist der Handschriftenschreiber der Rechtsbücher sehr frühe begonnen hat, noch allerlei andere Figuren zu (93 ≡)
zeichnen, die dem Zwecke einer raschen Auffassung von Verwandtschaftsverhältnissen und Graden dienen mochten. So mögen das Kreuz und das Fähnlein und das an einem langen Stiel filzende Parallelogramm, sowie der in Kreisform siebenmal getheilte Schild und manche andere geometrische Darstellung[12] schon lange um den Preis vollkommenster Anschaulichkeit gestritten haben, als man eine sehr merkwürdige Figur construirte, in welcher sich architektonische und naturalistische Motive ornamental zu vereinigen schienen. Die entscheidende Wendung in dem Aufbau des Verwandtschaftsschemas ergab sich dadurch, daß man die in einer einzigen Linie absteigenden Nachkommen von den weitverzweigten oberen Verwandten figuralisch trennte. Indem von der fraglichen Person, deren Verwandtschaftsgrade aufgezeigt werden sollten, Kinder, Enkel, Urenkel nach unten hin fortgesetzt wurden, bildete sich eine Art Säule, die ornamentirt einen Stamm vorstellen konnte, und welche den mannigfaltig entwickelten Kegel mit den oberen Verwandtschaftsgraden aller Voreltern mit ihren Geschwistern und deren Descendenten wiederum wie einen Baum mit seinen Aesten zu tragen schien. [13] Daß dieses ebenfalls uralte Schema sofort den Eindruck eines Baumes machen mußte, braucht nicht bloß vermutet zu werden, sondern läßt sich aus den Beschreibungen, (94 ≡)
beziehungsweise aus den bildlichen Ausdrücken erweisen, die jetzt auf diese Formulare mehr und mehr angewendet worden sind. Denn nun wird es verständlich, wenn Isidor die Worte truncus, radix, ramusculi gebraucht und selbst von einem Arbor juris spricht, welcher letztere Ausdruck dann wieder unterschiedslos bei jeder figuralen Darstellung von Verwandtschaftsverhältnissen vorkommt. Während, wie schon Stintzing bemerkt, ehedem nur von linea, gradus, descendentes, ascendentes die Rede war, und höchstens der Name stirps dem Bilde des vegetabilischen Lebens entlehnt worden ist, herrschen nunmehr die dem Baum entnommenen bildlichen Bezeichnungen vor. Man darf hinzufügen, daß jedenfalls unter allen überlieferten Verwandtschaftsformularen kein anderes, wie das beschriebene, die Phantasie in gleichem Maße zur Vorstellung des Stammbaumes erregen konnte. Denn wenn schon der ornamentirte Stamm auch Aeste und Zweige vermöge des ein Dreieck bildenden Aufbaues erwarten ließ, so bedurfte es nur noch weniger Verbindungsstriche um thatsächlich ein Bild zu geben, nach welchem sich von der Krone des Baumes zahlreiche Zweige herabsenken. Denn indem der Zeichner im Stamme von unten nach oben bis zum tritavi pater und zur tritaviae mater als zu dem siebenten Grade der Verwandtschaft in der Ascendenz vorgeschritten war, verfolgte er die Nachkommenschaft dieser beiden in zwei sich herabsenkenden Aesten, die sich zunächst horizontal neben den vom tritavus atavus, abavus abfallenden Zweigen nach unten hin breiter und breiter entwickeln, und ornamental stilisirt das unzweifelhafte Bild eines Baumes geben, der indessen mehr einer Traueresche als einer Eiche gleicht. Die ersten deutlich erkennbaren Stammbäume sind offenbar nichts anderes, als das zur Zeit Isidors bekannte und von ihm beschriebene Formular, auf welchem die Verwandtschaftsgrade statt mit Nummern versehen zu sein, als Aeste erscheinen, aus denen die Verwandtschaftsnamen in Blattform eingezeichnet sind.[14] (95 ≡)
Für die als Baum gedachte Form des Verwandtschaftsschemas wurde jedoch in späteren Jahrhunderten der Jurist Johannes Andree als eigentlicher Urheber in Anspruch genommen. Fast eine jede Darstellung dieser Art wird in den Handschriften des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts mit dem Titel Arbor Johannis Andree ausgezeichnet. Dieser war es, der den Stammbaum popularisirte, wie sich seine Anweisungen der Berechnung und Zählung der Verwandtschaftsgrade auch im praktischen Gebrauch bis in die neueren Jahrhunderte des größten Ansehens und der größten Verbreitung erfreut haben; Johannes Andree war der Sohn eines Priesters und Lehrers der Grammatik zu Bologna, um 1270 geboren und nach einer großen Gelehrtenlaufbahn zu Bologna an der Pest 1348 gestorben. [15] Das Werk, durch welches er so berühmt geworden ist, führte den Titel Summa oder Lectura super arboribus consanguinitatis et affinitatis und er sagt selbst, daß er schon im Beginne seiner Lehrthätigkeit glossas arboris geschrieben habe. Bemerkenswerth erscheint jedoch, daß die Formen des Verwandtschaftsschemas für Johannes Andree noch keineswegs so fest standen, wie seine dem Pflanzenreich entnommenen Bilder, denn neben der ausdrücklichen Aufforderung der Lectura einen Baum zu construiren, der die Grade der Familienverwandtschaft (96 ≡)
erkennen lasse,[16] heißt es dann doch wieder, das Schema könne nach Art eines Fähnleins, ad modum vexilli, construirt werden. Dieses vexillum ist indessen nur dadurch entstanden, daß man die eine Hälfte des Baumes abschnitt und die sämmtlichen Aeste vom Stamme aus nur nach der einen Seite hin laufen ließ; dieses vexillum ist aber bald nachher ebenfalls einem Baumornamente anheimgefallen und verschwindet als solches wenigstens dem Namen nach gänzlich, während sich die Bezeichnung als arbor consanguinitatis auch in solchen Handschriften siegreich behauptete, wo man über den Charakter einer eben nur oberflächlich gezeichneten Figur wol zweifelhaft sein dürfte. [17] Wenn indessen der Stammbaum sich als Schema lediglich aus den römischen Verwandtschaftsformularen und keineswegs aus einer ursprünglichen künstlerischen Idee entwickelt hat, so ist man leider doch nicht in der Lage ganz exakt den Zeitpunkt zu bestimmen, in welchem die thatsächlich überlieferten Genealogieen in figuraler Darstellung der Geschlechtsreihen sich des schematisch ausgestalteten Rechtsformulars zuerst bedient haben; und es ist eine verhältnismäßig recht späte Uebung, den zahlreich vorliegenden Genealogieen älterer und ältester Dynastieen und Familien eine tabellarische Darstellung zu theil werden zu lassen, die endlich im (97 ≡)
Stammbaum gipfelte. Lange Zeit hindurch sind die chronikalischen und annalistischen Mittheilungen neben den Stammbaumformularen der Rechtsbücher unvermittelt und beziehungslos einhergegangen, ohne daß man daran dachte, dem Blätterornamente, welches nur abstracte Bezeichnungen wie avus, proavus, nepos, pronepos u. s. w. tragen zu können schien, auch die wirklichen Namen bestimmter im Abstammungsverhältnis zu einander stehender Personen anvertrauen zu können. Noch ist uns der erste Entdecker dieses Gedankens unbekannt, und so wenig bedeutend der Schritt erscheint, welcher von den altrömischen Formularen der Verwandtschaftsgrade zur Darstellung wirklicher und persönlich bezeichneter Abstammungsverhältnisse gemacht werden mußte, so ist uns derselbe doch nach seinem Ursprung und in concreter Gestalt zur Zeit nicht nachweisbar, und wir müssen leider darauf verzichten, etwas bestimmtes über jene Epoche zeichnender Künste zu sagen, in welcher bildliche Darstellungen des Baumes zur Versinnbildlichung persönlich verzeichneter Familienverwandtschaften zuerst in Anwendung kamen. In zahlreichen Handschriften finden sich Genealogieen in reihenförmiger Gestalt vorgeführt und sind nichts anderes als Verzeichnisse von Namen die durch das Wort „genuit" genealogisch verknüpft erscheinen. Bei ehegerichtlichen Akten waren solche Verwandtschaftsdarstellungen ja canonisch erforderlich.[18] Aber auch die Chronistik bedurfte tabellarischer Übersichten. Einige der ältesten derartig gezeichneten Stammbäume finden sich in der Handschrift Ekkehards in der Jenaer Universitätsbibliothek.[19] Aber (98 ≡)
diese Darstellungen sind nicht anders gedacht, als unsere heute in jedem beliebigen Buche gegebenen tabellarischen Uebersichten von Verwandtschaftsverhältnissen. Es ist nicht die geringste Spur eines natürlichen „arbor“ oder „arboretum“ zu bemerken, sondern in regelrechter Abfolge von oben nach unten befinden sich die Namen von Vätern und Söhnen in Kreisen verzeichnet, welche durch Striche mit einander verbunden sind. Da sich auf dem einen dieser Stammbäume eine Nebenlinie von dem oben stehenden Otto Dux wie ein Fähnchen herabsenkt, so konnte leicht eine Täuschung entstehen, als ob es sich um ein baumartiges Ornament handelte, besonders wenn die Reproduktionen nicht eben sehr genau sind. Eine unzweifelhaftere Anwendung des Baums als Darstellungsmotiv für die Abstammung und Verzweigung der Geschlechter läßt sich dagegen seit sehr alter Zeit an malerischen und plastischen Kunstwerken beobachten, die der evangelischen Ueberlieferung von der Abstammung Jesu Christi gewidmet sind. Der älteste „Stammbaum Jesse“ dürfte wol derjenige gewesen sein, welchen die Aebtissin Herrad von Landsberg 1167-1195 in ihrer illustrirten lateinischen Encyklopaedie gemalt hat.[20] Das Charakteristische desselben dürfte ohne Zweifel in dem Aufsteigen des Baums aus einer figuralen wahrscheinlich Adam vorstellenden Darstellung erblickt werden; in dem Mitteltheil ist die Figur Abrahams und darüber die Köpfe aller Patriarchen und Könige; (99 ≡)
ganz oben ist Maria und Christus zu sehen, während in den Zweigen eine große Masse von Personen zum Theil in abenteuerlichen Zusammenstellungen erscheint. So wenig es sich hier um eine eigentlich genealogische Arbeit handelt, so ist doch die Idee des Baumes in voller Ausbildung als Sinnbild der Abstammung und Geschlechtsverzweigung benutzt. Ebenso zeigt sich in einem nahezu gleichzeitigen großen Kunstwerk jener Periode, in der Darstellung von der Abstammung der Maria und ihres Sohnes auf dem Deckengemälde der St. Michaelskirche zu Hildesheim das Baumornament, wenn man auch nicht sagen dürfte, daß es sich da um einen wirklichen Stammbaum handle.[21] Allein die Vorstellung von der geschlechtlichen Entwicklung als ein dem Baume vergleichbares Wachsthum ist unleugbar vorhanden. Da die Michaelskirche im Jahre 1186 geweiht wurde, so dürfte auch das Deckengemälde noch dem 12. Jahrhundert angehören. Etwas jüngeren Datums ist der in Marmor ausgeführte Stammbaum Christi unter den Basreliefs, womit die Vorderseite des Doms von Orvieto 1290 bis 1296 geschmückt ist.[22] Manches andere dieser Art findet sich auf Glasgemälden [23] und darf hier übergangen werden, da es (100 ≡)
sich nur darum handelt zu zeigen, wie sich die Idee des Baums in der Entwicklung der Kunst immer mehr zur festen Form des Generationsbegriffs gestaltete. Ob nicht dem Stammbaum Jesse im besondern noch eine gewisse Symbolik zu Grunde liegen möchte, die mit der Weltesche und dem Lebensbaum unvordenklicher germanischer Ideenkreise zusammenhängen kann, ist eine nach meiner Ansicht nicht zu unterschätzende Frage, die aber hier in gar keiner Weise angeschnitten zu werden braucht.[24] Kehrt man zu den eigentlich historisch-genealogischen Darstellungen zurück, so findet man als eine der ältesten Kunstleistungen dieser Art die stammbaumartige Ausschmückung der Burg Karlstein in Böhmen. Der niederländische Geschichtschreiber Dynter erzählt, daß er bei seinem Besuche in Böhmen das auf Befehl Kaiser Karls IV. hergestellte Wandgemälde selbst zu sehen Gelegenheit hatte. Leider ist aber seine Darstellung der Sache so wenig genau, daß man über die Form des Stammbaums keinerlei genügenden Aufschluß erhält, und auch die örtlichen Untersuchungen der neuesten Zeit haben keine Anhaltspunkte dargeboten, so daß sich nicht einmal sagen läßt, ob es sich um einen Stammbaum oder um eine Ahnentafel gehandelt habe. Jetzt sind aber in einem Wiener Codex des sechszehnlen Jahrhunderts prachtvolle Nachbildungen der Wandgemälde von Karlstein aufgefunden worden, welche Neuwirth in einem Prachtwerke herausgegeben hat. Die einzelnen Figuren der Tafel sind hier gleichsam zu einer Porträtgallerie der Vorfahren des luxemburgischen (101 ≡)
Hauses vereinigt worden. Die Auswahl der Bilder gestattet immerhin an eine Darstellung zu denken, welche die Form des Baums zur Grundlage nahm, indessen bleibt es ungewiß, ob es sich nicht doch vielmehr um eine Ahnenprobe gehandelt habe. Der Copist des sechszehnten Jahrhunderts scheint nur Werth auf die Einzeldarstellungen gelegt zu haben, wobei es ganz unsicher ist, wie weit die künstlerische Phantasie und Virtuosität des großen Zeitalters der Malerei nachgeholfen hat.[25] Jedenfalls kann darüber kein Zweifel sein, daß in dem sogenannten Stammbaum von Karlstein ein frühes Beispiel künstlerischer genealogischer Darstellung zu erkennen ist, bei welcher das Porträt dem historischen Gedächtnis zu Hilfe kommen sollte. Das sechszehnte Jahrhundert hat nachher auf die Ausbildung dieser Formen ein so großes Gewicht gelegt, daß der Werth des Inhalts dieser Darstellungen erheblich dagegen zurück trat. Je glänzendere bildliche Darstellungen in den Familien in Betreff der Abstammung geschätzt und beliebt waren, desto weniger genau nahm man es mit den Angaben, welche der Künstler auf Holz, Leinwand oder Kupfer verewigte. Die Zahl der Darstellungen von Stammbäumen, zum Theil in ungemein großen Dimensionen scheint sehr erheblich gewesen zu sein. Was sich davon erhalten hat verdiente sorgfältiger gesammelt und verzeichnet zu werden, als es der Fall ist. [26] Sehr bekannt war der durch Primissers Publication seit lange beachtete Stammbaum der Habsburger zu Ambras in Tirol. Anderes noch ist, wie es scheint den genealogischen, Liebhabereien Maximilians I. zu verdanken gewesen und es findet sich in Wien an der Hofbibliothek eine ganze Serie von großen (102 ≡)
Stammbaumdarstellungen, die bis in das 18. Jahrhundert sich fortsetzen.[27] Nicht weniger beliebt als die Stammbäume waren indessen die Ahnenproben, die man ebenfalls in der Form von Bäumen zur Anschauung zu bringen pflegte.[28] Doch hat sich für diese eine ein für allemale giltige Form durchaus nicht behaupten lassen, vielmehr sind die mannigfaltigsten Ornamente in Anwendung gebracht worden, um Ascendentenreihen zu verherrlichen. So ist die Ahnenprobe Herzog Wilhelms IV. von Baiern in der Münchener Bibliothek nichts anderes als eine Reihe von stilgerecht ornamentirten Wappen,[29] wogegen sich ebendaselbst eine interessante Ahnenprobe des Hector von Beroldingen befindet,[30] welche in ganz ähnlicher Weise wie der durch Estor bekannte Ahnenbaum der Familie Baumbach gestaltet ist. Uebrigens ist es für die Stammbäume so gut wie für die (103 ≡)
Ahnenbäume charakteristisch, daß die neuzeitliche Kunstepoche an die Stelle der in den römischen Rechtsbüchern durch tiefherabhängende Aeste charakterisirten Esche des nüchternen Verwandtschaftsformulars. Durchaus die breit nach oben mächtig verzweigte Eiche fast ausnahmslos zu setzen pflegt. Als eines der schönsten Werke dieser Art halte ich den im Besitze der Münchener Bibliothek befindlichen mit bewunderungswürdiger Feinheit ausgeführten großen, in Kupfer gestochenen Stammbaum des Johannes Herold von 1555, welcher die Wittelsbachische und Habsburgische Verwandtschaft auf den Merowingischen König der Franken „Thieterich“, phantastisch genug in seinem genealogischen Inhalt zurückführt. Die Arbeit verdient eine größere Beachtung, sie zeigt von dem großen Interesse welches die Wittelsbacher bis ins achtzehnte Jahrhundert diesen genealogischen Schaustellungen bewahrt haben.[31] Für den praktischen Gebrauch war freilich die monströse Behandlung genealogischer Dinge durch die Kunst überhaupt weniger geeignet, aber der Stammbaum hat sich trotz seiner Unbequemlichkeit für Zwecke des eigentlichen Studiums nicht mehr entwurzeln lassen, und treibt seine Blüten bis in unsere Tage, in denen Nachahmungen der alten figuralen Darstellungen wieder sehr beliebt werden. So war es wol auch als eine Nachwirkung der Stammbaumvorstellung zu betrachten, wenn auch da wo keine künstlerische Notwendigkeit dazu veranlaßte, die Descendenzen von unten nach oben dargestellt worden sind. In dieser Weise ist zum Beispiel in dem im Jahre 1592 gedruckten Buche des Dominikaners Joseph Texera, welcher die Vorfahren des Königs Heinrich IV. von Frankreich mit üblicher Phantasie auf Antenor, Dagobert und Garsias zurückführt, [32] das Baummotiv so sklavisch festgehalten daß man die schön gedruckten Tafeln stets von unten nach oben lesen muß. obwol nichts weiter als die in Kreisen stehenden Namen und die (104 ≡)
Verbindungsstriche an das Blätterorament erinnern können. Heute dürfte kaum jemand zum Zwecke des Studiums, unbeschadet der bereitwilligen Beibehaltung des ehrwürdigen Namens „Stammbaum“ solche künstlerische Verzierungen der ohnehin oft sehr verwickelten Verhältnisse der Genealogien noch für erwünscht erachten. Uebersichtlichkeit, Deutlichkeit und Klarheit sollten vielmehr die einzig maßgebenden Gesichtspunkte für die Abfassung der dem genealogischen Betriebe dienenden Tafeln sein, welche im Hinblicke auf den Inhalt dessen, was sie vermöge der heutigen wissenschaftlichen Erfordernisse mitzutheilen genötigt sind, ohnehin räumliche Schwierigkeiten der mannigfachsten Art verursachen. So wird sich jederzeit die einfache Abfolge der Geschlechter von oben nach unten am meisten empfehlen, aber nicht selten kann es vorkommen, daß die Quer- und Längstafeln oder auch gemischte Formationen dem besonderen Zwecke recht gut entsprechen, den man eben zu genealogischer Anschauung zu bringen beabsichtigt. Als vorzüglichster Gesichtspunkt für die Darstellungen der Stammtafel muß die deutliche Kennzeichnung der Geschlechtsreihen, oder der Generationen jederzeit und in erster Linie bezeichnet werden. Ohne die volle Klarheit der Generationenfolge hat jede Stammtafel etwas verwirrendes und selbst die trefflichsten typographischen Leistungen auf diesem Gebiete, wie etwa das schöne Werk von C. von Behr, lassen treue Berücksichtigung der Geschlechtsfolge nur allzusehr vermissen.[33] Am klarsten lassen sich die Abstammungen bei hervortretenden Generationsbezeichnungen erkennen und man hat es daher als einen Fortschritt der Darstellung anerkannt, als in meinem genealogischen Handbuch die Generationen durch rothe Linien kenntlich gemacht wurden. Sollte aber auch dieses System sich typographisch nicht verallgemeinern, so dürfte doch zu verlangen sein, daß geradlinige Darstellung des Generationenfortgangs mit absoluter Sicherheit festgehalten werde. Die Stammtafel bietet übrigens für die Darstellung jeder Art und unter allen Umständen gewisse Schwierigkeiten dar, die einerseits (105 ≡)
in den natürlichen und thatsächlichen Abstammungsthatsachen und andererseits in dem ungleichen Fortschreiten der Geschlechtsreihen begründet sind. A. Abstammung.Wenn man mit der Bibel voraussetzen würde, daß alle Menschen von einem Paare abstammen, so würden in der letzten darzustellenden Reihe von Nachkommen dieses Paares sämmtliche heute lebenden Menschen zu verzeichnen sein. In verkleinertem Maßstäbe tritt aber dieselbe Schwierigkeit bei der weitaus größten Zahl von Stammeltern hervor, die man an die Spitze einer Reihe von Nachkommen setzen mag. Nach einer Reihe von Jahrhunderten müßten, wie sich leicht begreifen läßt, die Nachkommen eines Paares zu einer ganz außerordentlichen, fast unübersehbaren Zahl gewachsen sein, wenn man auch nur eine gleichmäßige Vervielfältigung von drei oder vier Zeugungen für jedes nachkommende Familienglied annehmen würde. Thatsächlich zeigen auch die meisten bekannten Familienstammbäume eine so große Menge von Nachkommen männlichen und weiblichen Geschlechts wenigstens im Verlaufe gegewisser Zeiträume, daß es eine unmögliche Forderung wäre, eine vollständige Descendenznachweisung eines Stammelternpaares auf einer Tafel zu versuchen. Um die Übersichtlichkeit der Stammbäume nicht aufzugeben, hat man sich daher gleichsam stillschweigend in dem Prinzipe vereinigt, daß die Stammtafel eine Darstellung der Descendenz der männlichen Generationen unter gleichzeitiger Anführung der in jeder einzelnen Familie vorkommenden Töchter, aber unter Ausschluß von deren Nachkommen sein soll. In Folge dessen fallen auf allen Stammtafeln die Descendenten weiblicher Linien einfach weg, und die Darstellungen erhalten dadurch nicht nur einen mäßigeren und begrenzten Umfang, sondern, was noch wichtiger ist, sie gestaltet sich auf diese Art zu eigentlichen Stammtafeln von Familien. Sie verzeichnen demnach nur solche Mitglieder, die denselben Familiennamen führen und scheiden mithin diejenigen weiblichen Mitglieder aus, welche durch Heirat einer andern Familie, und mithin einem andern Stammbaum eingereiht worden sind. Als formales Prinzip der Aufstellung von (106 ≡)
Stammbäumen ist die Darstellung nicht der gesammten Descendenz eines Elternpaares, sondern die Darstellung aller einen und denselben Familiennamen tragenden Nachkommen eines Elternpaares zu betrachten. Diese durchaus praktische Anwendung des Familienbegriffs bei der Anfertigung von Stammtafeln darf jedoch nur nicht zu falschen Schlüssen über die Abstammungen und Nachkommenschaften überhaupt verleiten, da man sich stets zu vergegenwärtigen hat, daß unsere Stammbäume, eben weil sie Familienstammbäume sind, immer nur von einem Theile der Zeugungen Kenntnis nehmen. B.[GWR 9] Generationenfolge der Stammbäume.Wollte man den Versuch machen die ganze Nachkommenschaft eines Paares ohne Unterschied der Geschlechter aus einer Stammtafel zu verzeichnen, so ergäbe sich noch eine andere unüberwindliche Schwierigkeit, die ebenfalls in sehr sachlich merkwürdigen Umständen begründet ist. Bei der Verehelichung der männlichen und weiblichen Nachkommen eines Paares zeigt sich ein in natürlichen und sozialen Verhältnissen begründeter Altersunterschied, der sich im Laufe einer Reihe von Zeugungen zu einer vollständigen Verwirrung der Generationenabfolge steigern kann; die männlichen Enkel eines Paares werden fast regelmäßig viel jünger sein, als die aus der weiblichen Descendenz hervorgegangenen Nachkommen. Die Urenkelinnen der Schwester eines Stammvaters werden meistens schon eine volle Generation weiter vorgerückt sein, als des letztern männliche Nachkommen. Die vom Manne ausgehende Zeugung entwickelt sich in jedesmaliger männlicher Fortpflanzung so viel langsamer, als die im weiblichen Geschlecht fortgehende Abfolge, daß nach verwunderlich kurzen Zeiträumen weibliche und männliche Descendenzen durchaus nicht mehr auf derselben Geschlechtslinie stehen. Diese merkwürdige Erscheinung gehört zu den Dingen, die auch sachlich betrachtet eine außerordentliche Wirkung auf die Entwicklung der Menschheit ausüben, worüber, da der Gegenstand mehr naturwissenschaftlicher Art ist, an einem andern Orte die Rede sein wird. Hier soll nur das formale Prinzip ins Auge gefaßt sein, daß es überhaupt undenkbar wäre, eine generationenweise (107 ≡)
Darstellung auf einer Tafel zu geben, wenn man jedesmal die gesammten weiblichen und männlichen Descendenzen nebeneinander stellen wollte. Es braucht kaum noch aufmerksam gemacht zu werden, daß, falls man eine solche Darstellung versuchte, die Generationslinien keine geraden sein könnten, sondern in den sonderbarsten Curven verlaufen müßten. Daß diese nicht zur Deutlichkeit des Bildes beitrügen, ist klar, aber auch von dem Fortgange der Generationen selbst würde auf diese Weise eine völlig irrige Vorstellung entstehen, da diese überhaupt nur auf Grund der männlichen Zeugungen einen regelmäßigen Verlauf nehmen und daher auch nur nach dem System männlicher Zeugungen gezählt werden können. Wenn man auf einer Tafel 8, 9. 10 und noch mehr Geschlechtsreihen darstellt, so ist darunter nur verstanden, daß man eine Reihenfolge von Vätern und Söhnen im Auge hat. Man wird dann die Beobachtung machen können, daß sich die Descendenzen dieser Geschlechtsreihen durch lange Zeiträume hindurch in nahezu gleichen Altersentfernungen entwickeln. Eine nach dem Generationsprinzip verfaßte Stammtafel, welche die Abfolge männlicher Deszendenzen zur Anschauung bringt, wird in den meisten Fällen drei Geschlechtsreihen im Zeitraum eines Jahrhunderts zu berücksichtigen haben. Hierbei bleiben jedoch die ersten zwanzig bis dreißig Lebensjahre des Stammvaters ungerechnet, weil er in der Generationenreihe eigentlich von der Zeit an zu zählen ist, wo er in der Zeugungskraft einer Generation erscheint. Mit seinem Geburtsjahr steht er bereits um etwa dreißig Jahre vor den Generationsreihen, welche in ihrer Lebenswirksamkeit und Zeugungskraft zu je drei ein Jahrhundert ausfüllen.[34] Zählt (108 ≡)
man jedoch durch längere Zeiträume die Generationen fort, so wird man nicht selten Fälle finden, wo durchschnittlich 10 Generationen auf 300 Jahre zu fallen pflegen. Die Genealogische Zählung unterscheidet sich dabei von der statistischen dadurch, daß die letztere die durchschnittliche Lebensdauer aus der Summirung der Lebensjahre einer gewissen Anzahl von Personen gewinnt, woraus sich das mittlere ergibt, während die Genealogie die Periode der Zeugungskraft und Lebenswirksamkeit des männlichen Geschlechts als Mittel betrachtet um die Geschlechtsreihen darnach abzugrenzen. Der Werth und die Kunst der Darstellung einer Stammtafel werden um so großer sein, je deutlicher das Verhältnis von Generationen und Lebenswirksamkeiten zur Anschauung gebracht worden ist. Unter allen Umständen sollten die Geschlechtsreihen auf jeder Stammtafel, sei es durch Nummern, sei es durch Buchstaben, vielleicht durch eine von einem hervorragenden Vertreter einer Generation entlehnte Namensbezeichnung markirt werden. Bei den Reihen regierender Häuser gibt sich eine solche Charakterisirung an den hervorgehobenen Namen des jeweiligen Familienhauptes und Regenten leichter zu erkennen. C. Thatsächliche Mittheilungen auf der Stammtafel in Bezug auf die einzelnen Personen.Trotz der Einschränkungen, die sich die Stammtafel in der Mittheilung der weiblichen Descendenzen gefallen lassen muß. und trotz der strengen Wahrung des Charakters der Stammtafel als Familienstammtafel, bleibt immer noch ein sehr bedeutender Raum nötig, um alle Erfordernisse zu befriedigen, welche an den Inhalt (109 ≡)
derselben gestellt zu werden pflegen. Das Maß dessen, was man in Bezug auf die einzelnen Personen, also in Hinsicht auf die biographischen Mittheilungen von der Stammtafel erwarten dürfte, ist sehr verschieden und richtet sich nach dem besondern Zweck, welchen die Stammtafeln in jedem einzelnen Falle ihrer Abfassung im Hinblicke auf die geschichtliche Entwicklung der allgemeinen Fragen verfolgen, oder was durch dieselben im besondern an das Licht gestellt werden soll. Aber es ist nicht zuviel gesagt, wenn man für den Inhalt einer Stammtafel eine Art idealer wissenschaftlicher Vollständigkeit der Lebensumstände der auf derselben bezeichneten Personen voraussetzen kann. Damit ist aber ein Gedanke ausgesprochen, der nach allen Seiten hin einer genauen Erklärung und Begrenzung bedürfen wird. Daß aber das persönliche Leben der Mitglieder einer Familie durch die Stammtafel in allen Hauptpunkten des genealogischen Begriffs beglaubigt erscheinen muß, ist wol nie verkannt worden, und man hat sich daher seit alter Zeit daran gewöhnt, mindestens folgende Angaben auf jenen Stammtafeln gemacht zu sehen, welche dein allgemeinen genealogischen Zweck, und nicht irgend einer besonderen historischen oder naturwissenschaftlichen Unterweisung dienen sollen: (vgl. Gatterer S. 21.) 1. Die Herkunft. 2. Zeit und Ort der Geburt. 3. Stand, Amt, Würde. 4. Zeit, Ort und Art des Todes. 5. Die Vermählung mit gleichzeitiger Angabe von Herkunft, Geburt, Stand, Würde, Tod des Gemahls oder der Gemahlin. 6. Die Kinder sowol weiblichen als männlichen Geschlechts, mit Ausschluß der Nachkommen des ersteren. Da aber die Tafel Gelegenheit geben muß, wenigstens die Stammfortsetzung auch der weiblichen Descendenzen aufzufinden, so ist unter allen Umständen auch auf diejenigen Familien zu verweisen, auf deren Tafeln die Nachkommenschaft der nur persönlich verzeichneten weiblichen Sprossen eines Paares sich entwickelt. Durch die Außerachtlassung solcher Verweisungen wurden nicht selten irrthümliche Vorstellungen von dem sogenannten Aussterben von Familien hervorgerufen, die in statistischer, naturwissenschaftlicher und medizinischer Hinsicht geradezu verhängnisvoll wirken können. Für den darstellenden Künstler einer in so verhältnismäßiger (110 ≡)
Vollständigkeit ausgeführten Stammtafel ist eine reiche Gelegenheit gegeben auf Mittel zu sinnen, um bei möglichster Raumersparnis eine größtmögliche Menge von Daten mittheilen zu können. Man sucht sich durch Anwendung von Abkürzungen, Zeichen und Siglen die Sache zu erleichtern, für welche dann freilich bei jeder derartigen Arbeit ein eigener Unterricht in der Form von Zeichenerklärungen nötig ist. Eine wirkliche Verbesserung würde aber erst dadurch erreicht werden, wenn sich alle Genealogen auf ein gewisses System geeinigt hätten, nach welchen, aus der Reihenfolge von Daten die bezüglichen Ereignisse erkannt werden könnten. Dies würde allerdings voraussetzen, daß eine gewisse Uebung im Stammtafel-Lesen erreicht werde, was aber nur als erwünscht zu bezeichnen wäre.[35] Immer wird man aber daran zu denken haben, (111 ≡)
daß die Genealogie noch eine Reihe von Aufgaben zu berücksichtigen hat, die desto mehr hervortreten werden, je mehr sich diese Wissenschaft entwickelt und erweitert. Der Inhalt dessen, was von persönlichen Eigenschaften die Stammtafel zu übermitteln berufen sein wird, ist so außerordentlich verschieden und ausgedehnt, daß die graphischen Darstellungen in tabellarischer Form sich überhaupt nur als ein Hilfs– und Orientierungsmittel bezeichnen lassen werden, und daß das „genealogische Buch“ – um den Sprachgebrauch Gatterers nicht zu beseitigen – immer mehr und mehr in Ausnahme kommen wird, denn wenn die vorliegenden Tafeln sich noch so sehr bemühten, möglichst viele Details über die von ihr zu verzeichnenden Persönlichkeiten zusammenzutragen, so war man bis jetzt doch zufrieden die Thatsachen des äußerlichsten Lebens zusammengetragen zu finden; sollten auch die inneren Charactermerkmale, (112 ≡)
wovon in den nächsten Capiteln die Rede sein wird, in Betracht gezogen werden, so ist man genötigt sich nach anderen Formen der Darstellung umzusehen, bei welchen die übliche Tafel eine wesentliche Ergänzung und ausführliche Behandlung in dem genealogischen Buch finden wird, welches ihr zur Seite steht. Man wird sich überhaupt bald überzeugen, daß der Stammbaum, welches Ziel und welche Aufgabe er sich auch im besonderen gesteckt haben mag, ohne begleitenden Text kaum den wissenschaftlichen Fragen und Aufgaben heute mehr in seiner Isolierung zu genügen vermöchte. D. Genealogische Bücher.Die älteren Genealogen, welche bereits die Unmöglichkeit erkannten, alle Aufgaben der Wissenschaft in der tabellarischen Form des Stammbaums erfüllen zu können, haben mit der dem frühern Jahrhundert eigenen Neigung für scharfe Distinctionen verschiedene Arten von genealogischen Büchern unterschieden. Gatterer kannte sechs. Er bezeichnete die „Geschlechtshistorien“ als die vornehmste Art von genealogischen Büchern, und suchte noch den sogenannten „Genealogischen Geschichtsbüchern“ neben den „Geschichtsbüchern mit Stammtafeln“ und den „genealogisch-kritischen Büchern und Abhandlungen“ einen besonderen Charakter zuzuschreiben. Indessen beruht doch wol die Unterscheidung dieser Arten von Büchern nur auf zufälligen Aeußerlichkeiten und es wird wol niemand den Wunsch hegen, daß sich die Kritik der genealogischen Dinge von den genealogisch-historischen Darstellungen so sehr trenne, daß diese Dinge eben in verschiedenen Büchern abgehandelt werden müßten. Indem man also diese Auseinanderlegung von zusammengehörigen Aufgaben dem Pedantismus älterer Gelehrsamkeit wol überlassen kann, dürften dagegen das „genealogische Lexikon“ und der „genealogische Kalender“ in der That als sehr wichtige und besondere Arten des genealogischen Arbeitsbetriebs bezeichnet und in ihren besonderen Formen der Darstellung sehr sorgfältig zu erhalten sein. Daß sich beide Arten von Werken heute einer hohen Entwicklungsstufe erfreuen, konnte schon in unserer Vorrede rühmend hervorgehoben werden. (113 ≡)
Dagegen weichen die Darstellungen in den genealogischen Büchern in Betreff der anzuwendenden Methoden sehr wesentlich von einander ab, und man könnte kaum behaupten, daß sich ein feststehender Gebrauch gebildet hätte. Unter den neueren Werken dieser Art dürfen Haeutles „Genealogie des Stammhauses Wittelsbach“ besonders wegen der Mannigfaltigkeit und Reichhaltigkeit des zur genealogischen Erkenntnis gerechneten Materials und die vor kurzem erschienene Genealogie des Gesammthauses Baden von Oberstlieutenant von Chrismar wegen der sehr übersichtlichen Form der Darstellung als musterhaft bezeichnet werden. In dem letzteren Werke erleichtert die strenge Einhaltung des Generationenprinzips den Gebrauch der Tafel sowol, wie der in Buchform niedergelegten Personalnachrichten. In der tabellarischen Uebersicht bildet die deutlich sichtbar gemachte Reihe von Jahreszahlen und Namen der Mitglieder des Hauses seit Herzog Berthold von Zähringen zugleich den Schlüssel für Auffindung der Personen im Buche selbst, indem diese mit fortlaufenden Nummern versehen sind.[36] Wenn man vielleicht auch nicht in der Methode des Herrn von Chrismar heute schon die denkbar beste Form der genealogischen Darstellung eines Gesammthauses erblicken dürfte, so scheint doch hier ein Anfang gemacht zu sein, um die Aufgaben zu lösen, die dem Stammbaum gestellt sind, vielleicht ließe sich aus der Übersichtstafel von Personalnachrichten etwas mehr leisten, um das Bild der Generationenentwicklung plastischer zu gestalten, während der Text hinter den von Haeutle für die Wittelsbacher ins Auge gefaßten Charakterisirungen nicht zurückbleiben sollte. Bei sämmtlichen genealogischen Arbeiten ist endlich auch noch einer Wissenschaft zu gedenken, welche ihren formalen Ausdruck in der Darstellung der Stammbäume zum Zwecke der Erreichung (114 ≡)
ihrer Vollständigkeit zu finden pflegt: der Beziehung von Genealogie und Heraldik. Beide Gebiete sind, sofern der Stammbaum besonders in seiner historischen Bedeutung betrachtet wird, enge miteinander verbunden, und die Familiengeschichte des Adels läßt sich ohne Rücksicht auf heraldische Fragen kaum durchführen und kritisch erörtern. Indessen sind die Beziehungen dieser Wissenschaftszweige in dem Meisterwerke von umfassendster Gelehrsamkeit, welches J. Seyler als Einleitung zu der neuen Ausgabe von Siebmachers Wappenbuch veröffentlicht hat, so vollständig erschöpft, daß es genügt hier darauf hinzuweisen. Was die Ausstattung der Stammbäume mit den einschlägigen Familienwappen betrifft, so hat man in den älteren Zeiten mehr Gewicht darauf gelegt, als heute. Unter den Handbüchern der Genealogie von mäßigem Umfang ist dasjenige von H. Grote bemüht, die nötigen heraldischen Notizen in fachkundiger Weise präcise und kurz zusammenzustellen. Wenn es mehr und mehr eine gute Sitte werden sollte, wie zu wünschen wäre, daß auch wappenlose Familien die Pflege ihrer genealogischen Verhältnisse sich angelegen sein lassen, so wird für diese zwar die Bedeutung des heraldischen Studiums zurücktreten, aber wo heraldische Beziehungen bestehen, muß sie der Genealog nach allen Seiten beachten. Zu einer vollständigen Stammbaumdarstellung gehört wol auch die der Familienwappen; sie spielen freilich, wie sich zeigen wird, bei Darstellungen der Ahnentafel eine noch wichtigere Rolle. (115 ≡)
Nachtrag zu Seite 92–94.Max Conrat hat in seiner „Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter“, Leipzig 1891, den Darstellungen des arbor ebenfalls große Aufmerksamkeit zugewendet, und glaubt in der Handschrift der lex Romana canonice compta, Cod. Paris. 12448 das echte Justinianische Stemma gefunden zu haben, welches bis dahin für verloren galt. Wäre diese Vermutung richtig und es ist bei der Sorgfalt der Forschungen Conrats nichts anderes anzunehmen, so wäre damit der Beweis geliefert, daß die Stammbaumvorstellung sich nach Justinian entwickelte und mithin wirklich erst der Epoche Isidors oder diesem selbst original angehört. Denn der von Conrat vermutete Stammbaum ist eine geometrische Figur, kein Baum, Eine getreue Abbildung fehlt leider. Im Bollettino dell istituto di diritto Romano IV. 53, welches mir nicht zur Zeit einzusehen möglich war, ist in einer Florentiner Handschrift von F. Patetta noch ein anderes Stemma nachgewiesen, welches dieser für authentischer hält, als das im Cod. Paris. der lex Romana. Es scheint nun sicher zu sein, daß zu Justinian, Instit. III. 6, § 9, eben auch schon frühzeitig mannigfaltige Schemata bestanden haben, und daß von einer gleichsam offiziellen Form doch wol kaum zu sprechen sein dürfte. Bei der folgenden Auswahl der älteren und neueren Formen wird wol nur das eine als sehr wahrscheinlich gelten dürfen, daß sich die Figur IV aus III entwickelt hat, und daß die sich daran anschließenden Kunststammbäume der Renaissance, Figur V, sich naturgemäß als Phantasieprodukte der Ornamentierung eines ziemlich dürren schematischen Formalismus der römischen Jurisprudenz erweisen lassen.
(116 ≡)
(117 ≡)
(118 ≡)
(119 ≡)
(120 ≡)
(121 ≡)
Drittes Capitel.
Der Inhalt der Stammtafel.Ueber den stofflichen Inhalt der Stammtafel war man in verschiedenen Epochen der Vergangenheit und selbst bei verschiedenen Völkern sehr verschiedener Meinung. Das individuelle, gesellschaftliche und wissenschaftliche Bedürfnis war nicht immer dasselbe bei der Aufstellung von Stammbäumen. Bei den alten Völkern überwog das Stammes- und Familienbewußtsein. Der Stammbaum wollte eigentlich nur die Geschlechts- und Familienzusammengehörigkeit in Betreff eines bestimmten Individuums feststellen. Die ältesten Genealogieen beschränkten sich auf den Nachweis von Zeugungen in einer einzelnen Reihe und als selbstverständlich gilt es fast bei allen alten Völkern, nur die männlichen Descendenzen in Betracht zu ziehen. Auch in den älteren Zeiten der neueren europäischen Völker bieten die Stammbäume nichts, als die direkten Abstammungsreihen, wobei es zunächst als nebensächlich betrachtet werden darf, wie, viel Sicherheit den Ueberlieferungen derselben beizumessen ist. Die ost- und westgothischen Königsstammbäume. wie die spätfabricirten Stammbäume von Franken, Tschechen, [37]
(122 ≡)
Ungarn oder Polen zeigen, ganz abgesehen von ihrer Unglaubwürdigkeit. lediglich ein Interesse für die einfache Descendenzenreihe und wollen bloß Zeugnis ablegen für die Abstammung gewisser Personen von einem ihnen aus praktischen oder idealen Gründen erwünschten oder zur Begründung ihrer Rechte notwendigen Stammvater. Die Erkenntnis thatsächlich erfolgter Zeugungsreihen in dem vollen Umfange des Zusammenhangs von Eltern und Kindern ist den alten Zeiten der Weltgeschichte etwas durchaus fremdes. Die Stammtafel als ein in sich rnhendes Objekt der Forschung und der Wißbegierde ist keinesfalls vor den Zeiten humanistischer Gelehrsamkeit vorhanden und entwickelt sich im Sinne einer alle Theile der Descendenz umfassenden Darstellung erst in den neuesten Jahrhunderten. Diese Erscheinung ist nur dadurch zu erklären, daß sich der Familienbegriff selbst im Laufe der Zeiten immer mehr erweiterte und eben erst durch die Kunst der Darstellung in den Stammbäumen gedächtnismäßig zu entwickeln vermochte. Für den nach der Stammtafel unterrichteten Nachkommen Hugo Capets stellt sich das französische Königsgeschlecht als eine einzige große Familie dar, aber die Valois und Orleans und Bourbons sind trotzdem immer als besondere Dynastieen bezeichnet worden. Es ist daher keineswegs eine ganz einfache Sache, den Familienbegriff als Grundlage des Stammbaums kurz zu definiren; und B. Röse hat deshalb in seinem in der Ersch und Gruber'schen Encyklopaedie enthaltenen Artikel über die Genealogie das Auskunftsmittel gebraucht zwischen Familie im engeren und im weiteren Sinne zu unterscheiden. Er begreift unter Familie die Vereinigung der Eltern und der unter ihrer unmittelbaren Obhut stehenden Kinder, aber er sieht in der Verbindung der durch Blutsverwandtschaft mit einander vereinigten Geschlechter überhaupt ebenfalls eine Familie. Gewiß ist in dem einen Fall die Begriffsbestimmung zu eng und in dem anderen zu weit, und so muß man auch in der That zugestehen, daß alle Genealogie sich bis auf den heutigen Tag die Freiheit nimmt, das Wort Familie in dem verschiedensten Sinne zu gebrauchen und bald eine weitere, bald eine engere Gemeinschaft von Abstammungsverhältnissen darunter zu verstehen. In weitester Bedeutung fällt es dann durchaus (123 ≡)
mit dem Begriffe des Geschlechts, gens, zusammen, wobei wieder eine genauere Begriffsbezeichnung eigentlich nur bei den Römern, bei den neueren Völkern aber höchstens seit den späten Zeiten des sogenannten Mittelalters maßgebend war.
Die Verwandtschaftsverhältnisse des Stammbaums.Stammvater und Stammmutter erscheinen bei dem Umstande, daß alle Collektivbezeichnungen genealogischer Art immer nur etwas relatives bedeuten können, weil sehr wahrscheinlich alle, oder doch sehr große Theile von Völkern und Rassen in Abstammungsverwandtschaft stehen, als die eigentlichen Träger des Familienbewußtseins. Alle durch die Zeugungen eines Paares in ihrem Dasein bedingten Personen erkennen sich als Familienangehörige an, sie erweitern oder verengern sich in dem Maße, in welchem die Stammeltern in eine höhere oder tiefere Reihe oder Generation von Vorfahren gesetzt werden. Denkt man sich ein Stammelternpaar lediglich in der Eigenschaft als Eltern, so ist die Familie leicht zu überblicken in den Kindern. Denkt man jedoch das Stammespaar hinaufgerückt in die Eigenschaft und Stellung von Großeltern, Urgroßeltern bis zu den Uraltvätern, so erweitert sich der Stammbaum und mithin die Familie nach unten bis zu den Urgroßenkeln und es zeigt sich eine Abfolge von Zeugungen, die in Ansehung aller dabei in Betracht kommenden Personen immer wieder aus das als ursprüngliche Erzeuger gedachte Stammelternpaar zurückführen und im Hinblick auf die dazwischen liegenden Abstammungsverhältnisse je eines Vaters und seiner Kinder als Generationen oder Geschlechtsreihen bezeichnet werden. In der Geschlechtsreihe stehen aber die Kinder verschiedener Väter und Mütter, während in der Reihe, in welcher man den gemeinsamen Ursprung aller untereinander verwandter Personen aufsucht, nur Ein Stammvater und Eine Stammmutter stehen können. Demnach ist auch der Begriff der Blutsverwandtschaft, consanguinitas, von der Abstammung von einem Elternpaar abhängig, welches man in einer vorhergegangenen Generation als Ausgangspunkt einer Reihe von Zeugungen angenommen und nachgewiesen hat. (124 ≡)
Als Agnaten und Kognaten unterscheidet man die solchergestalt in Blutsverwandtschaft stehenden Personen in der Weise, daß man alle von väterlichen Seiten herstammenden Verwandten Agnaten und die von mütterlichen Seiten nachweisbaren Verwandten als Cognaten bezeichnet. Ebenso wichtig ist aber die Unterscheidung aller von einander in: Abstammungsverhältnis stehenden Geschlechtsreihen oder Generationen in Absicht aus ihre Eigenschaft als Vorfahren oder Nachkommen. Je nachdem man von einer bestimmten Geschlechtsreihe ausgehend die Eltern als solche und ihre Agnaten und Cognaten oder aber die Kinder in ihren Zeugungen in Betracht zieht, ergeben sich die Begriffe von Aszendenten und Descendenten. Auch diese haben selbstverständlich nur eine relative Bedeutung; sie sind auf jede in einer Abstammungsreihe befindliche Person anwendbar, denn jedermann kann als Ascendent oder Descendent gedacht und gezählt werden, vorausgesetzt, daß er selbst nicht kinderlos war, wodurch seine Eigenschaft als Ascendent wegfallen würde. Wenn nun auf einem Stammbaum Ascendenten und Deszendenten durch eine Reihe von Generationen zur Darstellung gebracht sind, so kann man an jeder beliebigen Stelle und bei jeder sei es männlichen oder weiblichen Person, wo immer durch den Abschluß eines ehelichen Verhältnisses ein neues Stammelternpaar auftritt, den Anfangspunkt einer neuen Familiengemeinschaft erkennen, wenn von diesen Stammeltern eine Anzahl von Kindern sich abzweigen, die ihrerseits wieder nach Eingehung ehelicher Verhältnisse Nachkommen gezeugt haben. Im Hinblick auf diese Eltern erscheinen nun die von ihren Kindern ausgegangenen Nachkommenschaften als Zweige eines Stammes, die sich genealogisch bezeichnet als Linien einer Familie oder eines Geschlechts darstellen. Die von einem gemeinschaftlichen Ahnherrn abstammenden Nachkommen können mithin jederzeit dadurch von einander unterschieden werden, daß sie eine dem Alter der Kinder desselben entnommene Zählung und meist auch besondere Benennung ihrer Linien auf ihre Nachkommen vererben. Solche Linien können dann von unten nach oben oder von oben nach unten vom Stammvater auf die Enkel und Enkelkinder oder von diesen zu jenem hin verfolgt werden, so daß man erhält: (125 ≡)
Und darnach wurde die Blutsverwandtschaft von den älteren Genealogen und Juristen auch bezeichnet als a) cognatio superior, b) inferior, und c) ex transverso oder a latere, womit man a) die Ascendenten, b) die Descendenten und c) die Collateralen zu verstehen pflegt. Die Reihenfolge der Collateralen bildet dann die Grundlage für die Verwandtschaftsberechnung, bei welcher wiederum linea aequalis und linea inaequalis zu unterscheiden ist. Bei den älteren und größeren Familien ist die Linientheilung auch meistens mit Erbtheiluug verbunden und erleichtert sich die Unterscheidung der Linien durch die Aufnahme von neuen Familiennamen, durch die der ältere Stammname ergänzt oder differenzirt wird. [38] Vom Standpunkt der natürlichen Abstammung betrachtet, lassen sich von den Kindern jeder engeren Familiengemeinschaft auch genealogische Linien ableiten, man spricht daher sowol von männlichen wie von weiblichen Linien, obwol der Stammbaum aus den formalen Gründen, die im vorigen Kapitel erörtert sind, die weiblichen Linien unter allen Umständen vernachlässigt. Indem aber genealogisch genommen jedes von den Geschwistern einer Familie Begründer einer Linie werden kann, so kommt bei der Oualifizirung derselben doch auch das Verhältnis in Betracht, in welchem diese Geschwister zu einander standen. Man unterscheidet leibliche und Stiefgeschwister (consanguinei und comprivigni) und (126 ≡)
bezeichnet sie nach genealogischem Sprachgebrauch als „vollbürtige und halbbürtige“ (bilaterales und unilaterales). [39] Daneben erwächst der Stammtafel eine gewisse sachliche Schwierigkeit aus dem Gegensatze natürlicher und bürgerlicher Verwandtschaftsverhältnisse und zwar nach zwei Richtungen hin, einmal durch die Anwendung des gesetzlichen Begriffs der Ehe im Gegensatze zu außerehelicher Zeugung und dann vermöge der Adoption fremder Kinder, die in den Besitz von Namen und Erbe ihrer Adoptiveltern gelangt sind und in dunkleren Epochen der Beurkundungen oft kaum von natürlichen Kindern geschichtlich unterschieden werden können. Je mehr man der anthropologischen Seite genealogischer Forschung notwendige Aufmerksamkeit schenken wird, desto wichtiger ist es aber, sich den Unterschied des natürlichen und bürgerlichen Stammbaums klar vor Augen zu halten. Es kann Fälle geben, wo die wahre und eigentliche Genealogie in den Abstammungsreihen natürlicher Kinder zu suchen ist, während der bürgerlich anerkannte Stammbaum anthropologisch werthlos sein mag. In diese Kategorie kann man auch solche Abstammungsreihen setzen, die sich an die Ehe zweier verwittweten Personen anschließen, die beiderseits Kinder aus erster Ehe mitgebracht haben. Für dieses (127 ≡)
bürgerlich nicht streng unterschiedene Stiefgeschwisterverhältnis fehlt es an einer näheren Bezeichnung, obwol dabei von Verwandtschaft nicht mehr die Rede ist. Und ebenso wird im gewöhnlichen Leben die Schwägerschaft, affinitas , das durch den Abschluß einer Ehe entstandene Verhältnis zwischen dem einen Ehegatten und seiner Verwandtschaft und den Blutsverwandten des andern mehr beachtet, als genealogisch begründet ist, doch entsteht der Stammtafel hierdurch keine Schwierigkeit, wenn sie von dem Prinzip der Zeugung und Abstammung sich nicht abdrängen läßt. Was die Stammtafel als Grundlage für alle andern Darstellungen zunächst als ganzes betrachtet zur Darstellung bringt, wird am deutlichsten in dem Begriff der Sippe oder Sippschaft ausgedrückt. Soweit geschichtlich erweisliche Erinnerungen reichen, gründet sich die Sippe auf die Zeugung, auf die Vorstellung vom gemeinschaftlichen Blut. Daher trat der bürgerliche und kirchliche Ehebegriff in ältester Zeit gegen das natürliche Abstammungsgefühl gar sehr zurück und gehörten auch die Kinder der Nebenfrauen zu der Sippe, wovon die genealogischen Verhältnisse der Merovinger und Karolinger noch genug deutliche Zeugnisse geben. [40] (128 ≡)
Verwandtschaftsberechnung.Aus den im Stammbaum sich entwickelnden Verwandtschaftsverhältnissen ergibt sich eine so große Menge von Wirkungen für das rechtliche und gesellschaftliche Leben der Völker, daß seit den Zeiten des Moses von demselben in keiner geordneten Gemeinschaft, in keinem staatlichen oder religiösen Verbände der Menschen abgesehen zu werden vermochte. Die Verwandtschaftsverhältnisse und in Folge dessen die Verwandtschaftsgrade kamen zur vollsten Geltung in erbrechtlichen und in eherechtlichen Angelegenheiten und fanden auch von Seite des Fiscus in Fragen der Besteuerung Beachtung. In den indogermanischen Urzeiten spielte zwar die Verwandtschaft in Rücksicht auf die Ehe kaum eine bedeutende Rolle, und auch bei den Griechen verschaffte sich der Stammbaum in Betreff der Heiraten sogut wie keine Geltung, doch sind die Inder sowol wie die Römer diejenigen gewesen, bei denen Verwandtschaftsberechnung sich notwendig zu einem wohlausgebildeten System rechtlicher Kenntnis entwickeln mußte. [41] (129 ≡)
Das römische Recht berechnet nun die Verwandtschaften nach dem Grundsatz quot generationes tot gradus, d. h. es werden die zwischen den beiden Verwandten liegenden Zeugungen gezählt.[42] In den schon früher besprochenen Verwandtschaftsformularen der römischen Jurisprudenz (vgl. Tafel I, II u. III) lassen sich die Verwandtschaftsgrade rasch ablesen, ohne daß eine besondere, die persönlichen Verhältnisse Stammtafelmäßig nachzuweisende Darstellung nötig war. War jemand als des Bruders oder der Schwester Urenkel oder Urenkelin bekannt, so sagte dem Steuerbeamten sein Schema rasch, daß er im fünften Grade mit dem Erblasser verwandt gewesen sei, wie es nicht viel Besinnen erforderte, daß Vater und Mutter, Sohn und Tochter mit demselben durch je eine Zeugung verbunden waren und also im ersten Grade der Verwandtschaft standen. [43] Die römische Kirche behielt zunächst die römische Verwandtenberechnung bei. Sie erweiterte jedoch den Verwandtschaftsbegriff, indem sie die Ehe unter Verwandten überhaupt innerhalb der siebenten Generation verbot. Hierbei macht sich jedoch die im germanischen Rechte ausgebildete Zählungsweise nach dem Grundsatz der Entfernung von dem gemeinschaftlichen Stammvater geltend, die auch als canonische Rechnung bezeichnet wird. Den römischen Begriffen von Agnation und Cognation entsprechen bei den Germanen die Hausgemeinschaft (Familie) und die Sippe Blutsverwandtschaft (parentela). Man berechnet die Parentel nach der Menge der Generationen die in direkter Linie zu einem Elternpaar führen, von dem zwei Personen als Descendenten abstammen. (130 ≡)
Dabei kann es vorkommen, daß zwei Verwandte bei der Berechnung ihrer Verwandtschaft d. h. der Nähe des Blutes zum gemeinsamen Stammvater verschiedene Grade zeigen, je nachdem die Linie des einen oder des anderen kürzer oder länger ist. Die fraglichen Personen sind also unter einander Verwandte sowohl im dritten wie im vierten Grade, wenn der eine Theil der Enkel und der andere der Urenkel des gemeinschaftlichen Stammvaters war. Unter Gregor IX. wurde, dann festgestellt, daß bei Ungleichheit der beiden Linien die längere für den Verwandtschaftsgrad bestimmend sein solle. [44] Will man eine Uebung in der Zählung der Grade erlangen, so vergegenwärtige man sich zunächst Descendenzreihen:
(131 ≡)
Im Ascendenzverhältnis macht sich zunächst eine Linienbetrachtung nötig, welche der Gradberechnung der Verwandtschaft vorausgeht. z. B.
(132 ≡)
longobardischen Recht zählt man die Generation des Stammvaters mit, im salischen Recht fängt man mit den Geschwistern, im ribuarischen erst mit den Geschwisterkindern an zu zählen. Diese drei Systeme und ihren Unterschied von der römischen Zählung möge folgende Tabelle veranschaulichen, in der die arabischen Ziffern die römischen Grade, die lateinschen dagegen die Generationen anzeigen:
(133 ≡)
Seit dem 18. Jahrhundert aber verbreitet sich die im Schwabenspiegel festgelegte altalamannische Zahlweise. die der salischen entspricht.
Die individuellen Verhältnisse des Stammbaums.Wenn man die Genealogie auf die Erkenntnis von Zeugung und Abstammung beschränkt gedacht hätte, so wurde sie sich nicht höher als zu einem erweiterten Stammregister entwickelt haben. Zu den direkten Linien von Ascendenten oder Descendenten würden nach den Bedürfnissen der Rechtsgelehrten und Steuerbeamten des römischen Reichs die Verwandtschaftsverhältnisse des Stammbaumschemas hinzugefügt worden sein. Aber der Wissensdrang ging schon sehr früh noch viel weiter. Indem man dem Andenken vergangener Geschlechter eine tiefere Aufmerksamkeit zuwendete und die Schicksale der Nachkommen schärfer beobachtete, individualisirte sich das Interesse an dem Stammbaum immer mehr. Die Entwicklung des Stammbaumes geht mit der der Biographie wenigstens in den neueren Jahrhunderten alsdann Hand in Hand. Wie sich diese Litteraturgattung im modernen Geiste durchaus nach ihrer psychologischen Seite zu vertiefen beginnt, so zieht sie das genealogische Bewußtsein mit Notwendigkeit nach sich und es wäre nicht unmöglich von den moralisirenden Lebensbeschreibungen der Heiligen bis zu der Darwinistischen Biographie der Neuzeit einen Faden zu spinnen, an welchem man als wesentlichste Entwicklung das genealogische Interesse wahrnehmen könnte, welches sich bis zu den physiologischen Phantasien des Romans und Dramas von Zola und Ibsen zu steigern vermochte. Betrachtet man nun diese Entwicklung im Hinblick auf die zu fordernden Leistungen des Stammbaumes. so ergiebt sich ohne Frage ein steigendes Verlangen nach Vervollständigung dessen, was derselbe sowohl in Bezug auf die Darstellung der in jedem Familienbilde vorgekommenen Zeugungsverhältnisse, wie auch in Bezug aus die für jede einzelne in der Reihe der Generationen zu erwähnende Person mitzutheilen und nachzuweisen haben wird. In Bezug auf beide Punkte war schon bei der Besprechung der Form des (134 ≡)
Stammbaums nach der Auffassung älterer Genealogen einiges wesentliche hervorzuheben. [46] Was das sachliche betrifft, so muß noch hinzugefügt werden, daß die Zwecke, die man bei der Aufstellung einer Stammtafel verfolgt, maßgebend sein werden für den Grad der Vollständigkeit mit welcher sowol die Personen wie die Personalnotizen anzuführen sind. Sofern es sich aber um Stammbäume handelt, die als eigentliche Grundlage für alle einzelnen Arten von genealogischen Betrachtungen dienen sollen, so kann man verlangen, daß dieselben in beiden Beziehungen alle Auskünfte ertheilen, welche zur Erkenntnis des ganzen Geschlechts wie jeder einzelnen Persönlichkeit nötig sind. Denn im weitesten Sinne des Wortes läßt sich kaum etwas finden, was in Betreff der Zeugungs- und Abstammungsverhältnisse einer Familie nicht wichtig sein könnte. Die Stammtafel in ihrer grundlegenden Bedeutung für die genealogischen Studien muß daher sämmtliche Nachkommen in jeder Generation enthalten, wobei es gänzlich irrelevant ist, ob die einzelne Person politisch oder sozial wichtig ist, oder nicht, ob sie lang oder kurz gelebt hat. Die Königin Anna von England erscheint in der Regentengeschichte des Reichs kinderlos, aber ihre Ehe gehört vermöge ihrer ungewöhnlichen Fruchtbarkeit und der auffallenden Sterblichkeit der Nachkommen zu den interessantesten genealogischen Beobachtungen. Die schwierigste Aufgabe ergibt sich aus der Feststellung der persönlichen Lebensumstände jedes einzelnen Mitgliedes der Stammtafel. Selbst noch zu den Zeiten des großen Fortschritts der genealogischen Wissenschaft um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts war man verhältnismäßig genügsam in Betreff dessen, was man auf der Stammtafel von Nachrichten persönlicher Natur erwartete. Was Gatterer an Angaben über die Lebensumstände der auf der Stammtafel angeführten Personen forderte, wurde früher erwähnt. Es bezieht sich auf das äußere des Lebensganges. Allein wenn man die Aufgaben ins Auge faßt, die der genealogischen Wissenschaft überhaupt zufallen, so muß man erheblich mehr Auskünfte von ihr erwarten. Schon der äußere Lebensgang (135 ≡)
muß viel vollständiger beachtet werden. Es genügt nicht zu schreiben, daß jemand geboren und gestorben ist; nichts ist merkwürdiger in dem Lebensgange einer Familie, als die Berufswahl ihrer einzelnen Mitglieder, womit die Stellung in ständischer und sozialer Hinsicht zusammenhängt. Es ergibt sich dabei nicht selten ein Auf- und Abwogen in der Bedeutung der Generationen, welches zu den verschiedenartigsten Schlüssen berechtigt. Man erfährt auf diese Weise aus den Stammtafeln, daß es gewisse Dispositionen für den Beruf der Mitglieder einer Familie giebt, oder daß diese Berufsarten von einzelnen Individuen durchkreuzt worden sind. Es giebt Kriegerfamilien. wie Pastoren- und Gelehrtenfamilien. Kunst und Handwerk sind bei weitem mehr mit der Familiengeschichte und Genealogie verwandt, als man gewöhnlich annimmt. Auch läßt sich eine eigenthümliche Erscheinung in der Art und Weise beobachten, wie sich in den Geschlechtsreihen und ihren Verzweigungen der vorherrschende Familientypus zuweilen verändert. Wenn man einen Stammbaum betrachtet wie den der Nachkommen des berühmten Köhlers, der durch den sächsischen Prinzenraub bekannt geworden ist, so nimmt man merkwürdiges wahr; immer steigen einzelne Mitglieder in die Reihen gelehrter Stände auf und immer sterben diese Zweige aus, während sich das Handwerk zeugungstüchtig erhält. Zahlreiche Beispiele bieten die Stammbäume des mittleren Adels für den Wechsel der Beschäftigung und der Standesgenossenschaft der verschiedenen Zweige und Linien einer Familie, und die Genealogien der in den Städten ansässigen oder dahin wandernden Familien machen die mannigfachsten biologischen Beobachtungen möglich. Die Stammtafel, sofern sie für genealogische Erörterungen ausreichendes Material bieten, gleichsam die Grundlage aller biologischen und sozialwissenschaftlichen Fragen werden soll, muß mithin ein möglichst vollständiges Bild der Lebensverhältnisse der Familien und ihrer einzelnen Glieder darbieten, sie muß mindestens den Beruf und die sozialen Stellungen derselben, wenn möglich auch die sonstige äußere Lebenslage zur Kenntnis bringen. Hieran schließt sich die Frage der inneren Eigenschaften. Die beste Stammtafel wäre ohne Zweifel die, welche ein volles Bild (136 ≡)
der Einzelnen, wie von ihrem körperlichen, so auch von ihrem moralischen Aussehen den Nachkommen zu vermitteln im Stande wäre. Leider muß man gestehen, daß die Geschichte von den körperlichen Eigenschaften der Mitglieder einer Familie nur in seltenen Fällen ausreichende Ueberlieferungen zu Gebote stellt; um so wichtiger ist für die Genealogie das Porträt. Seit den Zeiten, in welchen das Porträt überhaupt zur Geltung kommt, müßte keine Stammtafel ohne Personsbeschreibung erscheinen. Der Triumph der genealogischen Wissenschaft würde in der vollkommenen Versinnbildlichung der Individualität aller zu einem Familienstammbaum gehörigen Personen bestehen. Man könnte sich einen idealen Stammbaum vorstellen, auf welchem alle darzustellenden Personen in Abbildungen, etwa in Miniaturphotographien erscheinen. Indessen soll nicht verkannt werden, daß diese Forderung auch in unserm mit Sonnenstrahlen schreibenden Zeitalter nur im geringsten Maße zu erfüllen wäre, wohl aber giebt es eine nicht geringe Anzahl von Familien, bei denen allerdings viele wichtige Eigenschaften ihrer körperlichen Beschaffenheit aus allerlei geschichtlichen Ueberlieferungen zu erkennen sind und die in ihrem Familienzusammenhange eben durch diese erst recht verständlich und erfaßbar erscheinen. Es darf daher als Forderung aufgestellt werden, daß die genealogische Wissenschaft, wo immer sie Nachrichten über die Körperbeschaffenheit der Mitglieder eines Stammbaumes findet, dieselben auch sammelt. [47] In Betreff der moralischen Eigenschaften ist die Beschreibung der im Stammbaum vereinigten Persönlichkeiten allerdings noch schwieriger, aber wenn sich die Genealogie des wissenschaftlichen Characters nicht einkleiden will, so muß sie auch an dieses mühsame (137 ≡)
Werk der Forschung mit der Zeit herantreten. Ein Theil jener Fragen, die den Character der Nachkommen eines Stammvaters betreffen, beantwortet sich schon durch die Feststellung des Berufs und der Beschäftigung, anderes aber wird auf das Zeugnis der Quellen hin ausdrücklich bezeichnet werden können. Hierbei mögen Tugenden und Laster in Betracht gezogen werden und gewisse hervorstechende Familieneigenschaften werden unter allen Umständen in voller Sicherheit zu Tage treten. Erst wenn die wissenschaftliche Genealogie in systematischer Weise an diese Arbeit gegangen sein wird, ist eine exakte Lösung von einer Reihe von Problemen möglich, welche heute vergeblich von der Philosophie, oder von der Geschichte, oder von den Naturwissenschaften versucht wird. Es wird zweckmäßig sein, daß sich der Genealog bei seinen Arbeiten ein Schema gegenwärtig hält, welches er bei der Beschreibung der auf der Stammtafel darzustellenden Geschlechtsreihen so gut wie der einzelnen Personen auszufüllen haben wird. Wenn sich Viele methodisch vereinigten, nach dem gleichen Gesichtspunkt vorzugehen, so würde den verschiedensten Wissenschaften eine Hilfe gewährt werden können, die alle Erwartungen übersteigt. Nur in dieser Rücksicht kann es vielleicht erwünscht sein, eine Art von idealen Stammbauminhalt auszustellen, der sich etwa in folgendem Schema ausdrücken läßt.
(138 ≡)
Anschauung in Bezug auf die Vererbungsfrage vorgehen und darf die Benützung des so überlieferten Materials weiterer wissenschaftlicher Verarbeitung ruhig überlassen. Bei der Aufstellung von Eigenschaftsbegriffen vergangener Geschlechter darf man jedoch nie vergessen, daß man sich eben an die Ueberlieferung und folglich an diejenigen Begriffe zu hallen genötigt ist, welche der Geist früherer Zeiten unter seinen Bezeichungen von Tugend oder Laster verstanden hat. Glücklicherweise sind doch unsere Begriffe von schön und häßlich, gut und böse schon seit recht langer Zeit immer dieselben gewesen, so daß wir uns hier der Führung überliefernder Quellen ganz ruhig anvertrauen können. Wer freilich auf dem Standpunkt stände, daß das Eigenthum Diebstahl oder der Affenmensch das Ideal der Schönheit wäre, könnte sich überhaupt mit geschichtlichen Ueberlieferungen nicht verständigen, und er verfiele stets dem Narrenschiff Seb. Brants. [48]
Auswahl des Stoffes und besondere Arten des Stammbaums.Wenn man nur Stammbäume verfertigen wollte, die den aufgestellten und erwünschten Forderungen in allen Richtungen zum Zwecke der Erkenntnis des einzelnen Menschen wie der Geschlechter in ihrem Zusammenhange gerecht werden wollten, so fände man nur in den seltensten Fällen ausreichende Ueberlieferungen, um dieses Ziel zu erreichen. Es bleibt daher nur ein frommer Wunsch solche nach allen Seiten hin grundlegende genealogische Bücher zu besitzen. Thatsächlich werden Stammbäume meistens nur mit Rücksicht auf die besonderen Zwecke verfaßt werden, denen (139 ≡)
sie zu dienen haben. Man muß mithin den gleichsam ideal gedachten allgemein erforderlichen Inhalt der vollständig ausgeführten Stammbäume von den verschiedenen Arten unterscheiden, in welche dieselben nach ihrem Zwecke im besonderen zerfallen. Davon hängt die Auswahl des Stoffes ab, den die Stammbäume zur Darstellung bringen. Unzweifelhaft sind die besonderen Arten des Stammbaumes die im praktischen Betriebe der Wissenschaft die eigentlich gebräuchlichen und verdienen in jedem Falle die besondere Aufmerksamkeit des Genealogen. Drei große Wissenschaftsgebiete bedienen sich der Stammtafel zur Erkenntnis ihrer Aufgaben und zur Darstellung ihrer Lehren: die historisch-politische, die juristisch-staatswissenschaftliche und die naturwissenschaftliche. Dabei braucht wol hier nicht auf das verbreitete wenn auch nachgerade fast komische Vorurtheil eingegangen zu werden, als handle es sich dabei um eine Sache des Adels oder der regierenden Häuser. Wenn etwas zur Entschuldigung dieses Irrthums, der jedoch dem genealogischen Studium in unseren demokratisch denkenden Zeiten ziemlich viel geschadet hat, beizubringen wäre, so könnte allenfalls gesagt werden, daß derselbe aus der Natur der für die Stammtafel sich darbietenden Ueberlieferungen entstanden sein mag. Der vorhandene historische Stoff, aus dem die Stammtafel gebildet werden muß, beschränkt sich allerdings leider nur auf einen verhältnismäßig kleineren Kreis von Familien, da die größere Masse der bis heute zur Entwicklung gekommenen Menschheit ohne Familiengeschichte gelebt hat oder noch lebt und erst durch zunehmendes genealogisches Bewußtsein in den Besitz der für den Stammbaum nötigen Ueberlieferungen gelangt, was aber mit jedem Tage sich hebender Gesellschaftsverhältnisse besser zu werden vermag. Man darf sogar sagen, es gehört mit zu den Aufgaben der genealogischen Wissenschaft die Menschen anzuleiten für ihre Nachkommen das richtige Material zu sammeln, welches diesen die Aufstellung ihrer Stammbäume möglich machen wird. Hierbei wird es darauf ankommen, wie bei Ordnung und Benützung des schon vorhandenen historischen, so bei Schaffung des künftigen genealogischen Materials die richtige Stoffauswahl zu treffen. (140 ≡)
a) historisch-politische Stammtafeln.Die einfache Geschichtsdarstellung monarchisch regierter Staaten hat zu allen Zeiten das Bedürfnis hervorgerufen, die zur Regierung gekommenen Personen, sowie diejenigen die Hoffnung darauf oder Anspruchsrechte besaßen, in ihrem genealogischen Zusammenhange zu erkennen. Man kann daher wol sagen, daß es seit Herodot nie einen Geschichtschreiber gegeben hat, der sich nicht bemüht hätte die auf Erblichkeitsverhältnisse beruhenden Regierungsentwicklungen genealogisch darzustellen. Indessen ist die tabellarische Form solcher Nachweisungen im Alterthum und Mittelalter etwas unbekanntes gewesen, und hat sich erst aus den in Rücksicht auf das Familieninteresse entstandenen allgemeinen Stammbäumen entwickelt. Wer die fünf ersten römischen Kaiser in ihren Abstammungs- und Adoptionsverhältnissen auf Julius Cäsar zurückführte, fand zwar bei Tacitus, Suetonius, und den sonstigen auch späteren Geschichtschreibern alle wünschenswerthcn Nachrichten gesammelt, aber alle Genealogie dieser Art erscheint mit der Geschichtserzählung in unmittelbarer Verbindung und wurde erst in neuester Zeit aus den Gesammtdarstellungen ausgeschieden. In den Regententafeln sind daher die Personen hervorzuheben, auf welchen der Fortgang der Regierungen beruht; in den für die Erbfolgefragen entscheidenden Darstellungen kommt es besonders darauf an, die Verwandtschaftsverhältnisse durch geschickte Gruppierung derjenigen Personen, aus deren Verbindung oder Abstammung sich die Ansprüche nachfolgender Geschlechter ergeben, zur Anschaunng zu bringen; und wenn es darauf ankommt die geographische Entwicklung von Staaten und Familienbesitzungen aufzuzeigen, so spielen in den Erbschaftstheilungen einerseits und in den Länder- und Besitzvereinigungen andererseits nicht sowol die einzelnen Personen als vielmehr die Linien der jeweils regierenden Häuser die Hauptrolle. Klare und übersichtliche Darstellungen der genealogischen Linienbildung ist in dieser Beziehung ein Haupterfordernis der Stammtafel. Und da sowol Erbschafts- wie Regierungsfragen nicht selten sowol im Staatsleben wie in privatrechtlichen Verhältnissen sehr häufig durch Eheschließungen vorangegangener (141 ≡)
Geschlechter entstanden sind, so werden in sehr vielen Fällen die Besitz- und Erbschaftsansprüche von Frauen als ausschlaggebende Momente zur Darstellung gebracht werden müssen, wie auch in genealogischer Beziehung die den Stamm, die Linie, oder die engere Familie begründenden Mütter zu den wichtigsten Bestandtheilen historischer Stammtafeln zu rechnen sind. Eine gewisse Aufmerksamkeit der Geschichtsforscher suchte schon Gatterer auf die in verschiedenen Stammbäumen vorhandene Entwicklung der Gleichzeitigkeit der in Lebenswirksamkeit stehenden Generationen zu lenken. Dem politischen Leben der Staaten liegt ein Parallelismus zu Grunde, der sich in den Lebensläufen der regierenden Häuser einen häufigen, nicht selten räthselhaften Ausdruck giebt. Der Synchronismus der Ereignisse im Staatsleben leitet zu einer gemeinsamen Betrachtung des genealogischen Verlaufs der Stammbäume hin, und durch die nebeneinander hergehenden Wirksamkeiten verschiedener Abstammungsreihen erweitert sich der Generationsbegriff einzelner Zeugungsreihen zu einem gemeinsamen Merkmal der Gesellschaftsordnung. Die synchronistische Stammtafel ist mithin die einzig sichere Grundlage zur Aufstellung eines allgemeinen Begriffs der Generation, und wenn es kaum Historiker und kaum ein Geschichtsbuch gegeben hat, die den unendlich häufigen und bezeichnenden Gebrauch des Wortes Generation im collektiven Sinne entbehren mochten, so bedürfen sie der synchronistischen Stammtafel, um eine concrete Vorstellung von den parallel laufenden Geschlechtsreihen der verschiedensten Abstammungen zu geben. Die Generation im gesellschaftlichen Sinne des Wortes als Bezeichnung für eine Gesammtheit gleichzeitiger Lebenswirksamkeiten stellt sich im synchronistischen Stammbaum dar. Wollte man denselben unendlich erweitert auf alle Klassen von Menschen und auf alle Vertretungen von geistiger und politischer Thätigkeit ausgedehnt denken, so würde sich in ihm der Gesammtinhalt dessen, was man Kultur zu nennen pflegt ausdrücken. Die Vervollkommnung der synchronistischen Stammbäume ist daher eine eifrig anzustrebende Aufgabe der Genealogie. (142 ≡)
b) Rechtliche und standschaftlichc Stammbäume.Die zum Zwecke von Rechtsentscheidungen notwendigen Stammtafeln sind, wie schon aus der im zweiten Capitel entwickelten Geschichte der Stammbaumformen hervorgeht, die ältesten Darstellungen genealogischer Art, sie greifen in sehr verschiedene Gebiete ein und bedürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben meist gleichzeitig der beiden Grundformen der Genealogie, sowol des Stammbaums, wie auch der Ahnentafel. In Erbschaftssachen, seien dieselben privater, oder öffentlicher Natur fällt in der Descendenz die Linie und in der Ascendenz der Verwandtschaftsgrad der Collateralen ins Gewicht. Es ist daher keine ganz leichte Sache bei Rechtsstreitigkeiten Stammtafeln zu entwerfen, welche allen Anforderungen der Erkenntnis verwandtschaftlicher Ansprüche in der Descendenz und Ascendenz gleichzeitig entsprechen. Manchmal waren mangelhafte Vorstellungen über Stammbäume Ursache großer Verwirrungen im staatlichen Leben, und es ist daher erklärlich, daß die ältesten Rechtsgelehrten, wie sich gezeigt hat, zugleich die frühesten und gründlichsten Genealogen gewesen sind. Wenig Bedeutung hat der Stammbaum für die Fragen der Standschaft und der sozialen Stellung; denn für diese ist lediglich die Ahnentafel maßgebend. Es wird daher auch passend sein von diesen Verhältnissen da zu handeln, wo das Wesen der ’’Ahnentafel’’ zu besprechen sein wird. Der häufig vorkommende Sprachgebrauch von dem „Stammbaum“ welcher den Adelstolz begründet, gehört zu den Ungenauigkeiten, die in dieser Beziehung vorzukommen pflegen. Ein Adel, der bloß auf dem Stammbaum beruht, wird da, wo deutsche Standesbegriffe maßgebend sind, durchaus nicht als voll anzusehen sein, und zeigt sich seiner Natur nach wenig angesehen. c) Stammbäume zum Gebrauche der Naturwissenschaft.Noch vor nicht zu langer Zeit war der Irrthum allgemein verbreitet, daß die Genealogie lediglich wegen der in der Geschichte auftretenden Regentenhäuser und wegen der Standesvorurtheile einer Anzahl von Familien betrieben werde, die sich dem Zuge der Zeit in den Jahren der Gleichheit der Menschen wiedersetzten. (143 ≡)
Inzwischen hat sich das Bedürfnis, die Abstammung des individuellen Lebens genauer zu beobachten mehr und mehr in den Naturwissenschaften Bahn gebrochen und es besteht kaum ein Zweig biologischer Forschung, der sich nicht mit dem Stammbaum beschäftigt. In genauer Beobachtung der Zeugungs- und Abstammungsverhältnisse scheinen hierbei die landwirtschaftlichen Disciplinen vorangegangen zu sein. Thierzucht wird heute kaum in rationeller Weise anders als unter genauer Führung von Stammregistern betrieben werden, und die Besitzer von Rennställen wissen den Werth von Stammbäumen und Ahnenproben ganz genau zu schätzen. Es mag hier, obwol wir uns durchaus nur mit Genealogie des Menschen beschäftigen, doch der Exemplification wegen darauf hingewiesen werden, daß die Stammbäume bedeutender Thierzüchter neben der Mittheilung väterlicher und mütterlicher Rassen auch sehr eingehende Beobachtungen individueller Eigenschaften verzeichnen und hierin für Anlage menschlicher Ahnentafeln allerdings als Muster dienen könnten. Die Beobachtung persönlicher Qualificationen hat dann zu einer sorgfältigen Stammbaumlitteratur in den medizinischen Kreisen geführt, wo man jedoch gemäß der Natur des sich darbietenden Materials mehr nach pathologischen als physiologischen Gesichtspunkten verfährt. Auf diese Weise ist insbesondere für die Psychiatrie der Stammbaum heute zu einem wichtigen Zweige der Forschung geworden. In allen psychiatrischen Werken findet man den Gebrauch von Stammbäumen, wobei vielleicht der Wunsch ausgesprochen werden darf, daß eine strengere Scheidung der Begriffe von Ahnentafeln und Stammbäumen und demgemäß eine genauere Berücksichtigung dieser Grundlagen aller genealogischen Betrachtung Platz greifen möchte. ’’Dejerine’’ hat zuweilen auch historische Stammbäume zur Erklärung von nervösen Erkrankungen aufgestellt und außerdem eine große Anzahl von Privatpersonen auf ihre Stammbäume oder Ahnenverhältnisse untersucht. Aber die Bilder, die auf diese Weise zu erhalten waren, leiden häufig an einer Berücksichtigung von Collateralen, die ohne Zurückführung auf ein Stammelternpaar zu Schlußfolgerungen nicht geeignet sind (s. unten III. Theil Cap. 5.) (144 ≡)
Ich wage die Behauptung aufzustellen, daß die physiologisch-pathologische Forschung sich ganz strenge an die Grundformen der Genealogie (s. oben 1. Cap.) halten, und auf die willkürliche Vermischung von Stammbäumen und Ahnentafeln verzichten müßte, wenn sie zu sicheren Schlüssen gelangen wollte. Sollte sich aber den in den sonstigen genealogischen Gebieten gebrauchten Systemen eine gleichsam gemischte Darstellungsweise für diese Wissenschaften rechtfertigen lassen, so müßte dies jedenfalls als eine Unterabtheilung genealogischer Formen näher begründet werden. Der gleiche Wunsch dürfte vielleicht auch für die von neueren Psychologen unternommenen genealogischen Forschungen gelten. Stammtafeln, welche die Berufseigenschaften gewisser Familien zur Anschauung bringen sind seit längerer Zeit im Gebrauche. Man hat auf dem genealogischen Wege sichergestellt, daß es Maler und Musikerfamilien giebt und daß selbst gewisse Wissenschaftszweige zu Familieneigenthümlichkeiten sich entwickeln. Priester und Krieger sind seit den ältesten Zeiten als Stände angesehen worden, die sich kastenartig fortpflanzen lassen. Solche Eigenschafts-Stammbäume, sei es pathologischer, physiologischer oder psychologischer Art haben sich heute schon als festbegründete Formen genealogischer Darstellungen allenthalben eingeführt und sollten nur eine ein für allemal giltige Bezeichnung erhalten, um dem System der Genealogie eingefügt werden zu können. Im allgemeinen wäre es von etwaigen Unterabtheilungen abgesehen, schon sehr nützlich, wenn man diese Darstellungen mit dem Namen „biologische Stammbäume“ bezeichnen würde. (145 ≡)
Viertes Capitel.
Von dem Beweise der Genealogischen Tafeln.
Für den Genealogen kommen, wie für alle historische Forschung, die Quellen in Betracht, auf die er sich zu stützen im Stande ist. Daß ihm mündliche Ueberlieferung oder Versicherungen, wenn es sich um Ausstellung neuer und neuester Stammbäume oder Abstammungsfragen von vorhergehenden Geschlechtern handelt, genügen könnten, wird doch nur in einem ganz beschränkten Sinne und in eng begrenztesten Kreisen höherer Bildung bejaht werden können. Aller genealogische Dilettantismus beruht seit unvordenklichen Zeiten, man könnte sagen seit Moses, auf der mangelnden Energie des Geistes der Nachkommen, die Traditionen als solche abzuweisen. Der wissenschaftliche Betrieb der Fachmänner dagegen bemüht sich in der angegebenen Richtung lieber zu viel, als zu wenig zu thun. Dagegen wird bei der Anlage von Stammtafeln neuesten Datums, die zum Zwecke physiologischer oder psychologischer[GWR 10] Untersuchungen gemacht worden sind, das Bedenken nicht erspart werden können, daß sie häufig auf gänzlich ungenügenden Zeugnissen beruhen. Es ist klar, daß man einer festen Norm bedarf, um genügende und ungenügende Quellen zu unterscheiden. Zu diesen ist strenge genommen jede Art bloß erzählender oder berichtender Geschichtsdarstellungen zu rechnen, zu jenen dürfte man eigentlich nur solche Urkunden zählen, die den Zweck haben Abstammungsverhältnisse rechtlich und gesetzlich zu beglaubigen. Indessen käme die Genealogie mit der Aufstellung von Grundsätzen von solcher Strenge eben nicht weit und es wird also auch in genealogischen Fragen,
(146 ≡)
wie bei allen geschichtlichen Dingen sich um eine Stufenleiter von größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit handeln, welche durch die Natur der, sei es mündlichen, sei es schriftlichen Quellen zu erlangen ist. Für die Quellen, die für die Genealogie verwendbar sein werden, hat schon Gatterer eine Art System aufgestellt, welches auch heute noch wiederholt werden darf, da es eine leichtfaßliche Anweisung für jedermann enthält, seine Familienforschungen auf eine möglichst sichere Grundlage zu stellend. [49]
Die in den Archiven vorhandenen Register und Registraturvermerke, alle Auszüge aus Kirchenbüchern, insonderheit Taufscheine, Trauungsbescheinigungen, Nekrologien der Stifte (Todtenbücher) auch die neuern Todtenregister und Friedhofsverzeichnisse, Auszüge aus Lehns- und Salbüchern. Gatterer glaubt auch den Aufzeichnungen von eines Vaters eigener Hand über Leben und Sterben der Kinder, ferner gewissen Zeugnissen von Beamten und endlich den seit dem 15. und 16. Jahrhundert vorkommenden Familienstammbüchern. sowie den Leichenpredigten wenigstens in Ansehung der Eltern und vielleicht der Großeltern urkundlichen Werth beilegen zu können.
(148 ≡)
(149 ≡)
(140 ≡)
4. Geschlechts-Geschichts-Wappen- und andere Bücher.Eine Reihe von Aufzeichnungen genealogischer Art seit den ältesten Zeiten des Mittelalters fallen unter die Kategorie von Büchern überhaupt und können in gewissem Sinne als beweiskräftige Quellen angesehen und benutzt werden. Indessen ist vor dem häufig vorkommenden Irrthum zu warnen, als ob für diesen ganzen Zweig genealogischer Litteratur die Frage des Alters derselben viel zu bedeuten hätte. Besonders liebt es die dilettantische Familienforschung sich auf alle, sei es gedruckte, oder geschriebene Bücher zu berufen. Aber gerade in genealogischen Dingen ist das sogenannte „alte Buch“ gewöhnlich die unbrauchbarste Sache von der Welt. Die moderne sogenannte exakte Kritik hat freilich durch Einseitigkeit und Uebertreibung in Betreff der ausschließlichen Werthschätzung gleichzeitiger Geschichtsquellen den Vorurtheilen des genealogischen Liebhaberthums bis zu einem gewissen Grade neue Nahrung gegeben. Dem gegenüber muß nun ausdrücklich bemerkt werden, daß in allen auf genealogische Buchlitteratur bezüglichen Angelegenheiten der neuere und neueste Darsteller fast stets eine größere Autorität und Glaubwürdigkeit in Anspruch nehmen kann, als der alte, wenn man von demselben eine gewissenhafte Arbeitsweise voraussetzen darf, weil das heute zur Verfügung stehende urkundliche Material in genealogischen Dingen erheblich größer ist, als dasjenige, welches selbst den besten Schriftstellern älterer Zeiten vorgelegen hat. Die neuesten genealogischen Forscher sind daher im Stande die ältesten Bücher, die unter dem Namen „Genealogieen" überliefert sind weit zu überflügeln, und wer z. B. über die Stammbäume der Agilolfinger oder der Wittelsbacher (151 ≡)
das verhältnismäßig sicherste wissen will, muß seine Kenntnis bei Riezler suchen und nicht in den „alten Büchern“. Diese sind, welchen Namen sie auch tragen, nur im uneigentlichen Sinne „Quellen" und ihr Werth hängt weder von ihrem Alter noch von ihrer Verfasserschaft, sondern lediglich von der Art und Weise ab, wie sie ihre Ueberlieferungen glaubhaft zu machen, oder die gegen sie jederzeit vorhandenen Verdachtsgründe wahrscheinlicher Irrthümer zu beseitigen im Stande sind. Von einer Unterscheidung oder einer ein für allemale feststehenden Terminologie der verschiedenen Arten genealogitcher Bücher dürfte heute kaum die Rede sein können. Die etwa noch von Gatterer festgehaltenen oder zurechtgemachten Distinctionen und Definitionen haben sich nicht einmal im Sprachgebrauche erhalten, weil die verschiedenen Arten, in welchen genealogische Ueberlieferungen in Büchern auf uns gekommen sind, überall das ganz subjektive Gepräge des Darstellers an sich tragen. Alles was den Gebrauch der für die Genealogie sich darbietenden Quellen betrifft, hängt der Natur der Sache nach von jenen Ueberzeugungen ab, welche man in historischen Dingen überhaupt befolgt und zur Anerkennung bringen zu können meint. Da liegt jedoch ein Capitel vor, welches in einigen ganz besonders das Gebiet biologischer Fragen streifenden Richtungen auf eine eigenthü{u}mliche Beurtheilung Anspruch erheben könnte:
Besondere kritische Fragen.Genealogische Quellen und Ueberlieferungen unterliegen in Ansehung der Abstammungsfrage der Mitglieder eines Stammbaums noch einer besonderen Schwierigkeit, die für den Historiker überhaupt meist nur eine sekundäre Bedeutung hat. Mündliche und schriftliche Beglaubigungen der Geburt eines Menschen vermögen zwar das mütterliche, aber nicht das väterliche Elternverhältnis sicherzustellen. Der Rechtsgrundsatz: Pater est, quem nuptiae demonstrant, kann für den Stammbaum in höchster wissenschaftlicher Bedeutung keine Geltung beanspruchen. Die historische Regententafel braucht sich mit der Frage, ob die Abstammung eines Thronfolgers echt oder unecht ist, nur zum Theil zu beschäftigen; (152 ≡)
für die äußere Geschichte genügen jene Annahmen, welche durch Urkunden, durch die Ueberzeugung oder das Stillschweigen der Betheiligten und durch die allgemeine Meinung (communis opinio) gewährleistet sind, aber für die innere Geschichte des Stammbaums und für die Benutzbarkeit desselben in Betreff von Fragen, die für die psychologische und physiologische Forschung wichtig sein werden, bedarf es auf alle Fälle einer weiteren kritischen Ueberlegung, und einer noch viel strengeren Prüfung der Zuverlässigkeit des Stammbaums einer Familie, die zur Grundlage biologischer Forschung dienen soll. Diese Frage hier methodologisch zu erörtern ist daher unbedingt geboten. Zur Sicherung der ehelichen Geburt enthält das römische Recht eine Reihe eingehender Vorschriften, welche die Grundlage von vielen Gebräuchen geworden sind, die sich bis auf den heutigen Tag bei Feststellung legitimer Successionsansprüche erhalten haben. Der von seiner Frau geschiedene Mann wird durch das Senatus Consultum Plancianum gegen Unterschiebung eines Kindes geschützt, indem dasselbe von der Frau verlangt, daß sie ihre Schwangerschaft dem Manne innerhalb 30 Tagen nach der Scheidung anzeigt und der Mann berechtigt ist Wächter zu schicken; auch kann der Mann Untersuchung der Frau durch drei Hebammen und Bewachung der Frau anordnen. Ebenso ist die Frau eines verstorbenen Mannes verpflichtet den Erben desselben von ihrer Schwangerschaft Mittheilung zu machen, und dreißig Tage vor der zu erwartenden Niederkunft Aufforderung zugehen zu lassen, „ut mittant, qui ventrem custodiant“. Treten Kennzeichen der baldigen Niederkunft ein, so sind Anstalten zu treffen, daß Zeugen der Geburt in dem Hause einer ehrbaren Frau, in welchem die Entbindung stattzufinden hat, anwesend seien. Vorsorglich ist sogar bestimmt, daß das Zimmer, in welchem das Kind geboren werden soll nur eine Thüre haben dürfe.[53] Nach ganz ähnlichen Grundsätzen ist bei der Geburt von Nachkommen fürstlicher regierender Familien noch in unseren Zeiten (153 ≡)
verfahren worden. Sofern Hausgesetze dabei in Betracht kommen, zeigt sich freilich eine große Verschiedenheit. Doch sind die Beurkundungen der Geburt von Successionsberechtigten Söhnen meist unter der Zeugenschaft von Personen vollzogen worden, die sich in der Nähe der gebärenden Mutter befanden, im Vorzimmer auf ausdrückliche Aufforderung versammelt waren und das neugeborene Kind alsbald gesehen haben. Wer die Geburtsbeglaubigungen zum Zwecke genealogischer Untersuchungen prüft, muß sich eben mit den in einer Familie sei es hausgesetzlich oder gewohnheitsmäßig feststehenden Gebräuchen vertraut gemacht haben.[54] Durch gesetzliche und gewohnheitsrechtliche Bestimmungen ist zu allen Zeiten demnach dafür gesorgt worden, daß die stattgefundene Geburt eines Kindes von der Mutter hinreichend sichergestellt und demgemäß beglaubigt wurde. Das Senatus consultum Plancianum handelte auch von der Strafbarkeit der Unterschiebung eines Kindes von Seite der Mutter, als eines Kapitalverbrechens, welches an dieser, sowie an der Hebamme, die das Kind (154 ≡)
herbeigeschafft hat, durch den Tod gesühnt wird.[55] Eine viel geringere Sicherheit wird der Genealog dagegen aus den gesetzlichen und rechtlichen Verhältnissen für die Abstammungen vom Vater gewinnen können. Der Filiationsbeweis ist durch den seit den Zeiten der Römer bei allen modernen abendländischen Völkern zur Regel gewordenen Grundsatz, daß die Paternität durch die Ehe praejudicirt sei,[56] überall in das ungewisse gesetzt. Das Kind muß so lange für ein rechtmäßiges Kind des Ehemanns gehalten werden, bis das Gegentheil von dem Manne auf eine solche Art, die keinen Zweifel übrig läßt, dargethan worden ist. Hiebei zeigt sich in der Geschichte der Gesetzgebungen sogar die Neigung den Nachweis der illegitimen Geburt eines Kindes dem Vater zu erschweren, denn bei den Römern galt noch die Vorstellung von der heiligen Siebenzahl des Pythagoras, wornach für die Schwangerschaft mindestens sieben Monate nötig seien, um ein lebensfähiges Kind zur Welt zu bringen. In den neueren Gesetzgebungen gilt die Paternität für unbestreitbar, wenn die Anwesenheit des Mannes bei der Frau zwischen dem 300. und 180. Tage vor der Geburt des Kindes constatirt ist.[57] Auch im neuen deutschen bürgerlichen Gesetzbuch ist die Anfechtung der Ehelichkeit ausgeschlossen, wenn ehelicher Verkehr der Gatten zwischen dem 302. und 181. Tage (155 ≡)
vor der Geburt des Kindes stattgefunden hat, und überhaupt immer, wenn der Vater das Kind nach der Geburt anerkennt.[58] Nach dem französischen Recht ist es fast kaum, oder nur sehr schwer möglich den Nachweis des physischen Unvermögens gegen die Paternität zu führen und in allen Fällen hat in der Rechtssprechung die rechtliche Vermutung für die Paternität des Ehegatten durchaus im Vordergrund der Entscheidungen gestanden. Der Genealog würde einen sehr vergeblichen Kampf gegen die seit den Zeiten des römischen Rechts in der Welt geltenden Vorstellungen führen, wenn er sich aus kritischen Erwägungen verleiten ließe, Anfechtungen der Ehelichkeit und Abstammung zu versuchen, welche von dem zeitlichen Richter nicht anerkannt worden sind. [59] Man wird mithin bei der Aufstellung von genealogischen Tafeln einen wesentlichen Unterschied zu machen genötigt sein, und je nach dem Zwecke, den dieselben verfolgen, eine ganz verschiedene Beurtheilung des Werthes der Geburtsbeglaubigungen der zu untersuchenden Personen eintreten lassen müssen. Für die rechtliche und soziale Geltung des Stammbaums, so gut wie der Ahnentafel, ist die rechtlich beglaubigte Urkunde die ausreichende und völlig erschöpfende Filiationsprobe. Will man dagegen gewisse biologische Fragen auf Grund des Stammbaums, oder der Ahnentafel beantworten, so versteht sich von selbst, daß der Genealog vor der bürgerlichen Urkunde nicht stehen zu bleiben vermag und sich bei auftauchenden Zweifeln einer richtigen Filiation durch das Zeugnis des Pfarrers, oder des Standesbeamten nicht zurückschrecken lassen darf, die Sache des weiteren zu untersuchen. Nun giebt es Zweifelsüchtige, welche in Folge dieser Betrachtung der Genealogie überhaupt jeden Werth für biologische Untersuchungen absprechen möchten; ginge man aber so weit, so wäre auch zu (156 ≡)
fragen, mit welchem Rechte der Arzt am Krankenbette eines Menschen irgend welche Schlüsse aus der besonderen Abstammung desselben ziehen dürfte. Trotzdem macht die heutige psychiatrische Wissenschaft die weitestgehenden Folgerungen auf Grund rein persönlicher Angaben über Verwandtschaften und Abstammung. Die Frage ist daher nur die, welche relative Sicherheiten die Wissenschaft als solche zu gewinnen vermag, und innerhalb welcher Grenzen sich hier eine gewissenhafte kritische Forschung bewegen kann. Hierbei wird man von einer unanfechtbaren Voraussetzung ausgehen können. Durch die rechtsgiltige Beglaubigung der Geburt eines Kindes erhält die wirkliche physische Abstammungsfrage immerhin eine wenn auch nicht materielle, so doch moralische Sicherstellung. Wenn der Ehegatte im Augenblicke der Geburt eines Kindes seiner Ueberzeugung Ausdruck giebt, daß er an dem ehelichen Erzeugungsakt keinen Zweifel hege, so wird wenigstens in der bei weitem größten Masse von Fällen die Glaubwürdigkeit vollkommen auf seiner Seite sein. Die Zweifelsucht hat hier wenigstens nicht mehr Grund als in jedem beliebigen Falle menschlichen Thuns und Lassens. Es ist daher durchaus billig zu verlangen, das; die Begründung des Zweifels zunächst der gegnerischen Seite obliegt, bevor die genealogische Forschung sich in jedem einzelnen Falle damit abgeben kann in eine Untersuchung einzutreten, die über das beurkundete Protokoll hinausschreitet. Indessen liegen die Fälle vor und sind nicht selten, daß sich Meinungen gebildet haben, vermöge welcher nicht nur die väterliche, sondern auch selbst die mütterliche Abstammung bei einem ordnungsgemäß beglaubigten Geburtsakt bereits zu Lebzeiten der betheiligten Personen bestritten worden sind. Von dem Sohne Napoleons III. wurde, wie von Jakobs II. Sohne in England behauptet, dieselben seien unterschobene Kinder gewesen. Der Bestand einer Schwangerschaft der Kaiserin Eugenie war unter Hinweis auf die von ihr damals wieder hervorgesuchte Mode der Crinoline geläugnet worden. Häufiger sind noch aus leicht erklärlichen Gründen die Zweifel an der Paternität. Sie treten manchmal mit einer so überwältigenden Stärke auf, daß der Genealog sich Gewalt anthun und aus der streng wissenschaftlichen Betrachtung heraustreten müßte, wenn (157 ≡)
er den Stammbaum an solchen Stellen zu biologischen Zwecken ruhig fortsetzen wollte. Es ist für den Stammbaum der dänischen Könige rechtlich zwar ganz belanglos, ob die im Jahre 1771 geborene Tochter der Königin Mathilde Christians VII. Kind gewesen sei, oder nicht, wohl aber kann die genealogische Wissenschaft als solche die Augen vor der Wahrscheinlichkeit nicht schließen, daß die Ahnen einer großen Anzahl von heutigen fürstlichen Familien in den Pastorenhäusern der Provinz Sachsen zu suchen sein werden und nicht auf dem Throne von Dänemark. In manchen Fällen findet sich das unsichere Urtheil in Betreff der Anerkennung eines Kindes von Seite des Vaters offen ausgesprochen. Heinrich VIII. verläugnete zuerst seine Tochter Elisabeth und machte sie dann doch zu seiner eventuellen Nachfolgerin. Nicht für unbedenklich galten in den Augen gleichzeitiger und späterer Menschen oftmals solche Ehen, bei denen sich ein auffallend spätes Kinderglück einstellte, wie bei der Gemahlin Ludwigs XIII. nach 23 jähriger Unfruchtbarkeit. Noch häufiger werden solche Zweifel in den älteren Jahrhunderten der Geschichte erwachen, wo die Zeugnisse über die Geburten noch so unvollkommene sind. Die Stammmutter der Habsburger, Johanna von Pfirdt gebar vier kräftige blühende Söhne ihrem lahmen Gatten, als dieser schon in höherem Alter stand, während die Kinder aus den ersten Jahren der Ehe auffallend rasch nach der Geburt gestorben waren. Wer an der Lust und Neigung leidet so viel Zweifel wie möglich den historischen Dingen entgegenzusetzen, findet hier ein ungemein ergiebiges Feld. Die Frage, die sich erhebt, ist jedoch eine ernste. Soll man auf eine genealogische Wissenschaft, die über die äußersten Aeußerlichkeiten hinausgehen will, Verzicht leisten? - Es kann natürlich nur davon die Rede sein, ob sich verständige Ueberlegungen machen lassen werden, welche die Abstammung so weit sicherstellen, oder wenigstens für dieselbe einen so hohen Grad von Wahrscheinlichkeit annehmbar machen, daß es der Mühe werth zu sein scheint, gewisse Schlußreihen unseres Denkens an die so angenommenen Thatsachen anzuschließen. Alle historische Kritik ist nichts weiter, als eine Vertrauenssache. Die Ueberzeugung von der Richtigkeit einer urkundlich beglaubigten (158 ≡)
Nachricht beruht bloß darauf, daß man voraussetzt, der Aussteller des Zeugnisses sei kein Lügner gewesen. Wenn sich trotz der vorhandenen Zeugenaussage in irgend einer Sache Zweifel erheben, so können sie nur durch sogenannte innere Gründe beseitigt werden. Diese letzteren liegen auf dem Gebiete der Genealogie in mancher Beziehung viel klarer zu Tage, als bei andern Zweigen des historischen Wissens, weil die Ereignisse der Geschichte auf die mannigfachsten Ursachen zurückgeführt werden und Handlungen in derselben Weise von den verschiedensten Menschen in völlig gleicher Weise vollbracht worden sein können. Die Thatsachen des Lebens dagegen beruhen auf natürlichen Voraussetzungen, die von der freien Wahl unabhängig sind. Ein schwarzes Kind kann von weißen Eltern nicht abstammen und wenn der Satz von der Erblichkeit und Uebertragung der Eigenschaften von einem Individuum auf das andere auch in seiner Allgemeinheit wenig Handhaben für die Abstammungsbeurtheilung geben kann, so ist gerade die Genealogie damit beschäftigt die Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten der Individuen festzustellen und gewinnt aus dieser Beschäftigung Wahrscheinlichkeitsmomente, die jedenfalls für die Frage der Abstammung und Zeugung auch im besondern Falle verwendbar sind. Es ist nicht nur eine Gewohnheit, sondern selbst ein natürliches Bedürfnis der Menschen im täglichen Leben, die Abstammungsähnlichkeiten zwischen Eltern und Kindern festzustellen, und die Vergleichung physischer und psychischer Eigenschaften ist etwas so allgemeines, daß es überflüssig wäre, besondere Gründe für die Beweiskräftigkeit häreditärer Beschaffenheit in Bezug auf Abstammung anzuführen. Die Genealogie kann in ihrer entwickelten Gestalt eine außerordentliche Verschärfung des Urtheils über die ererbten Merkmale der Nachkommen bewirken und durch die Erkenntnis längerer Reihen von väterlichen Eigenschaften eine von Fall zu Fall gesteigerte Sicherheit für den Zusammenhang von Aehnlichkeiten erbringen, die dann nur auf die Zeugung zurückgeführt werden können. Diese Erkenntnisquelle nährt sich selbstverständlich von einer Aufgabe, die selbst wieder eine genealogische ist, und die in denjenigen Theilen unserer Wissenschaft zu besprechen und näher kennen zu lernen sein wird, die sich mit den (159 ≡)
allgemeinen biologischen Fragen der Geschlechtskunde berühren. (III. Theil dieses Lehrbuchs.) Hier wird nur so viel gesagt zu werden brauchen, daß in allen Fällen zweifelhafter Abstammungen, die biologische, sowol physische wie psychische Untersuchung mindestens eine sehr wesentliche Ergänzung der materiellen Beglaubigungsurkunde darbieten wird und daß das, was man den biologischen Filiationsbeweis nennen darf, die wissenschaftliche Genealogie ermöglicht und grundlegend sicherstellt, wie diese umgekehrt wieder zur Beurtheilung des einzelnen Falles die wichtigsten Hilfsmittel darbietet. Man denke beispielsweise an den schon erwähnten Fall der Königin Elisabeth von England. Gleichzeitige und spätere Geschichtsschreiber haben in den Eigenschaften der Königin Elisabeth die echte Tudor erkannt. Obwol die genealogische Beschreibung des Geschlechts heute noch keineswegs mit jener Genauigkeit durchgeführt worden ist, die erwünscht wäre, so wird sich doch kaum ein Historiker finden, der den Zweifel ihres Vaters nicht für sehr unbegründet halten dürfte. Aber diese Einsicht gewinnt man bewußt, oder unbewußt nicht aus den Prozeßakten und Urkunden, welche Froude u. a. zur Geschichte der unglücklichen Anna Boleyn benützt haben, sondern vielmehr vorzugsweise aus einem biologischen Filiationsverfahren, das man nicht selten für untrüglicher halten wird, als so manche Eintragungen in Kirchenbüchern oder irgend welche standesamtliche Erklärungen. Faßt man das eben Erörterte demnach zusammen, so ergibt sich als Erkenntnistheoretische Grundlage aller Abstammungsverhältnisse die übereinstimmende auch von dritten nicht bestrittene Angabe der Ehegatten. Sie ist die Voraussetzung aller genealogischen Wissenschaft, und verdient im allgemeinen vollen Glauben. Sie wird sich durch Aussagen von Personen kontrollieren lassen, die als Zeugen bei der Geburt eines Kindes herbeigerufen worden und in urkundlicher Form alsdann die Abstammung desselben von bestimmt genannten Eltern beglaubigen konnten. Weitere Sicherheiten bietet der in allen Zeiten sich bildende Leumund, der in der geschichtlichen Ueberlieferung zum Ausdruck gelangt. Und endlich wird die genealogische Forschung selbst in der Betrachtung und Erkenntnis (160 ≡)
häreditärer Eigenschaften und Familienbesonderheiten ein wesentliches Mittel der Kontrolle aller äußeren Zeugnisse und Überlieferungen aufdecken und solchergestalt dem urkundlichen Filiationsbeweis noch ein besonderes Merkmal und eine wesentliche Stärkung geben. Indem wir uns nun anschicken dem äußeren Abstammungsbeweise unsere besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, hat man sich zunächst einer Schwierigkeit zu erinnern, die daraus entsteht, daß der regelrechte Urkundenbeweis für Zeugung und Geburt verhältnismäßig spät in der Quellenlitteratur des Rechts und der Geschichte aufkommt und daß die Genealogie, je höher sie in obere Generationen steigt, desto weniger in der Lage ist, sich auf solche Zeugnisse zu stützen, die einen amtlichen Character zu tragen pflegen. Indem man daher genötigt ist die historische Ueberlieferung im weitesten Umfange des Gebrauchs in die genealogische Forschung hereinzuziehen, bedarf es einer Reihe von Erwägungen, die sich zunächst auf die allgemeinen kulturellen und litterarischen Verhältnisse vorangehender Zeiten und dann weiters auf die besonderen geschichtlichen Hilfswissenschaften beziehen werden.
I. Allgemeine Erwägungen.
(161 ≡)
Fälschungen, die sich durch die Stammväter kennzeichnen, welche man herbeizuziehen strebt. Mit zu den ältesten Versuchungen gehört, wie er meint, das trojanische Pferd. In der That weist der Glaube an Trojanische und griechische Abstammung tief in das Alterthum zurück und schließt sich eigentlich unmittelbar an die Vorstellungen von der Abkunft der Heroengeschlechter von den Göttern an. Die nächst beliebten Abstammungsfabeln schließen sich an Augustus und seine Nachfolger an. und diese Vorstellungen beherrschen mit Vorliebe die Zeiten, in denen das Studium des Alterthums blüht. Da findet man dann das Bestreben überhaupt mit altrömischen Familien neurömische zu verknüpfen und überdies den deutschen Adel aus dem römischen hervorgehen zu lassen. Dann sind es die Karolinger, deren Stammbäume als Ursprung späterer Familien aufgesucht zu werden pflegen, und endlich ist durch die Turnierbücher eine leidenschaftliche Neigung entstanden die Stammväter in den Zeilen König Heinrichs I. und unter den Turnierrittern zu finden, welche besonders in Rüxners Fabelbuch zuerst mit verschwenderischer Hand vorgeführt worden sind. Man darf noch hinzufügen, daß der Wunsch vieler Geschlechter auch heute noch dahin geht, die Familienväter wenigstens unter dem Adel der Kreuzzüge zu suchen. Der Stammbaum der Habsburger hat auf diese Weise alle Phasen des historischen Vorurtheils durchgemacht: er ist je nach der Mode der Zeit aus Priamus, auf die römische Aristokratie, und auf die Karolinger zurückgeführt worden. Lustige Beispiele dieser Art führt Gatterer noch weiter an: die Abstammung der Herzoge von Litthauen von einem Bastard des Kaisers Augustus, den Ursprung des Badischen Hauses in den Zeiten des Kaisers Ve{s}pasian, die Abstammung der Familie Welser von Belisar und die der Hohenzollern von den Colonna u. a. m. Es braucht kaum erst bemerkt zu werden, daß die genealogische Fabel sich leicht an den bezeichneten Stammvätern erkennen läßt und daß es in Fällen dieser Art eigentlich keiner langathmigen Beweise bedarf. Gatterer hat recht, wenn er sagt, daß es überhaupt keinen neuern Stammbaum geben darf, an dessen Spitze römische oder karolingische Kaiser geduldet werden können. Indessen (162 ≡)
gibt es genealogische Ueberlieferungen, die noch im allgemeinen einen historischen Werth haben können, wo ihnen jede persönliche Bedeutung abzusprechen ist. Als eine nicht zu unterschätzende Beobachtung darf es immerhin festgehalten werden, daß genealogische Erinnerungen in einem Geschlechte, sofern sie überhaupt einmal vorhanden waren, sich viel länger als glaubwürdig erweisen, wie andere historische Thatsachen. Das mechanische System der ausschließlichen Glaubwürdigkeit der Zeitgenossen, womit die heutige Geschichtschreibung ihre Blößen zuzudecken pflegt, ist nur mit Vorsicht für die genealogische Forschung zu gebrauchen. Es ist vielmehr zuzugeben, daß Leute, die überhaupt von einem Familienbewußtsein getragen sind, allemal ihre Großväter und selbst Urgroßväter anzugeben wissen, und daß man diese Aufstellungen gelten lassen darf, auch wenn keine früheren urkundlichen Beglaubigungen vorhanden sind. Wenn also kein Grund vorliegt aus anderweitigen Motiven auf eine beabsichtigte Täuschung zu schließen, so darf man wohl den genealogischen mündlich und persönlich gemachten Angaben, sofern sie eben nur aus Interesse für das genealogische gemacht sind, allerdings bis zur zweiten und selbst dritten emporsteigenden Generation ein gewisses Vertrauen entgegen bringen. [60] Wenn irgend ein Erzähler von den Königen der Gothen Nachrichten sammelte, so ist durchaus nicht abzusehen, warum er von den Großvätern und selbst Urgroßvätern der Könige Theodorich oder Alarich nicht sicheres mittheilen sollte. Und ganz dasselbe darf der heutige Mensch ebenso gut für sich in Anspruch nehmen. Wenn er seinen Stammbaum ausarbeitet, so wäre doch wahrlich nicht einzusehen, warum man seinen Angaben ein Mißtrauen entgegensetzen sollte, wenn er etwa von seinem Groß- und selbst Urgroßvater Namen, Stand, Charakter u. s. w. mittheilt, wenngleich er auch nicht die leiseste Spur eines urkundlichen Zeugnisses über diese seine Vorfahren beizubringen im Stande sein mag. Es ist keine Frage, daß die Kritik, um das schon gesagte immer wieder zu wiederholen, zu einer gemeinen Verneinungssucht ausarten (163 ≡)
würde, wenn sie alle nicht gleichzeitig beurkundeten Familienerinnerungen läugnen wollte. Vor dieser Eigenschaft ist aber der Genealog zu warnen, besonders deshalb, weil der zu erwartende Fortschritt der Genealogie davon abhängt, daß auch solche Familien, die durchaus nicht immer im öffentlichen Leben gestanden haben, Stammbäume haben und besitzen sollen. Wollte man aber das sogenannte kritische Prinzip festhalten, daß jedermann nur das glaubhaft überliefert, was er selbst erlebt hat, so würde man zu einer Logik kommen, bei der jedermann erst urkundliche Beweise beibringen müßte, daß er selbst geboren worden sei und einen Vater hatte. So wünschenswerth es auch ist. daß die Aufstellung von Stammbäumen mit der größten Sorgfalt und unter möglichster Herbeiziehung jeder Art von schriftlichen Beglaubigungen geschehe, so bestimmt mag es betont werden, daß die mündliche Ueberlieferung für die meisten genealogischen Nachrichten über eine Strecke von kaum viel weniger als hundert Jahren ihr volles Recht und eine sehr beachlenswerthe Bedeutung besitzt. Im übrigen ist die Werthbeurtheilung genealogischer Nachrichten so nahe verwandt mit der bei historischen Erörterungen überhaupt erforderlichen Kritik, daß man wol behaupten dürfte, der Genealog wird in seinem Urtheile meistens durch seine Auffassung geschichtlicher Dinge überhaupt geleitet sein. Da es aber eine exakte Regel für das was historisch sicher oder nicht ist, in keinem Falle gibt, so kann es sich nur empfehlen, durch die von guten Mustern gegebenen Beispiele sich ein gewisses Talent anzueignen, das wahre vom falschen zu unterscheiden, denn in diesem undefinirbaren Empfinden liegt das was den Geschichtsforscher macht. Gewisse Anhaltspunkte für die Sicherung seiner Urtheile gewinnt er jedoch insbesondere aus den Beobachtungen der Diplomatik und der Rechtswissenschaften. Was diese dem Genealogen besonders nahe legen, wird im folgenden zu erörtern sein. II. Rechte und Titel aus ständischen Verhältnissen hergeleitet.Sehr wichtig für genealogische Untersuchungen ist die .Kenntnis derjenigen Theile des deutschen Staats- und Privatrechts, (164 ≡)
die sich mit Rechten und Titeln der verschiedenen Stände beschäftigen. [61] Die Vieldeutigkeit der hierhergehörenden Ausdrucke in den Quellen bereitet dem Genealogen oft große Schwierigkeiten. Ein alphabetisches Verzeichnis der wichtigsten Standesbezeichnungen wird ihm daher wohl nicht unwillkommen sein.
(165 ≡)
(166 ≡)
(167 ≡)
(168 ≡)
(169 ≡)
(170 ≡)
(172 ≡)
(173 ≡)
III. Personenn und Familiennamen.Auf dem Zusammenhange und dem Bewußtsein der bürgerlichen Familie ist die genealogische Wissenschaft in erster Linie aufgebaut. Für die Forschung ist daher die Entstehung der Personen- und Familiennamen von der größten Bedeutung. In der geschichtlichen Entwicklung der Völker gewährt der Gebrauch der Eigennamen als Individualbezeichnung, wie als Familien- und Stammesbezeichnung einen gewissen Einblick in den psychologischen und gesellschaftlichen Fortgang der Dinge, auf welchen ohne Zweifel (174 ≡)
gewisse allgemeine, anthropologisch - kulturelle Betrachtungen gegründet werden könnten. Im allgemeinen darf man sagen, daß es sicherlich eine tiefere Stufe bezeichnen mag, wenn sich die Völker zur Kenntlichmachung des Individuums zunächst nur des Zusatzes des Namens des Vaters bedienen. Es liegt dann schon ein gewisses schärfer hervortretendes genealogisches Bewußtsein darin, wenn auch noch weitere Zusätze, des Großvaters, der Mutter, oder des Stammes der Individualbezeichnung hinzugefügt wurden. Wir sind hier weit entfernt auf diese die genealogische Specialforschnng nicht weiter berührenden Entwicklungen einzugehen, deren höchst beachtenswerthes kulturgeschichtliches Interesse jedoch durchaus nicht in Abrede gestellt werden dürfte. Ein großartiges die Genealogie besonders förderndes System der Personen und Familienbezeichnungen haben erst die Römer hervorgebracht, nachdem schon bei Griechen und Italern die Stammes- und Vaternamen in regelmäßigeren Gebrauch gekommen waren. Aber doch erst die vorwiegende und scharfe Hervorhebung des Familennamens machte die Aufstellung von ausgedehnten und vielverzweigten Stammbäumen möglich, wie sie seit der Zeit des Uebergangs von der republikanischen zur monarchischen Verfassung für geschichtliche und rechtliche Verhältnisse grundlegend waren.[102] Alsbald ließ sich aus dem feststehenden Familienbegriff durch Hinzunahme von Beinamen solcher Stammväter, deren Nachkommen sich als Seitenlinien gruppirten, ein festes genealogisches System erbauen. Die Aemilier unterscheiden sich als Lepidi und Scauri, durch welche letztere Bezeichnung auf einen Stammvater hingewiesen wurde, der wegen der fehlerhaften Gestalt seiner Füße so benannt worden ist und seinen Beinamen auf seine Linie vererbte, gleichwie es unter den Aureliern ebenfalls Scauri gab, die aber gar nicht mit den Aemiliern verwandt waren. Das genealogische System erhält durch den strengen Familienbegriff, der im Gentilnamen Ausdruck findet, sein Rückgrat in ganz anderer Weise als bei den Völkern (175 ≡)
die sich mit patronymischen Namensbezeichnungen behelfen. Der ursprüngliche Eigenname wird zum Vornamen <tti>praeneomen; während an Stelle des Vaternamens, der nicht mehr regelmäßig vorkommt, Beinamen folgen, die teils individuellen Eigenschaften, teils einer Differenzierung des Stammnamens ihren Ursprung verdanken. Dieser letztere tritt seit dem vierten Jahrhundert d. St. mehr und mehr hervor. Die Cornelier unterscheiden sich als Maluginenser, Cosser, Scipionen u. s. w. Man unterscheidet patricische und plebejische Geschlechter, aber jede vollständige Personenbezeichnung setzte sich aus praenomen, nomen gentilicium und cognomen zusammen. Bei der Trennung der Linien eines Geschlechts gelangt das cognomen zu immer größerer Bedeutung. Man redet von den „Scipionen“; daß sie Cornelier waren gilt theils als selbstverständlich theils als nebensächlich. In Folge dessen geräth das strenge Namensystem seit den Flaviern in einigen Verfall. Bei Tacitus findet sich manchmal das cognomen an Stelle des Praenomen, dann verschwindet hinter der Hervorhebung des Beinamens auch der Gentilname mehr und mehr[103], doch ist mit so abgekürzter Bezeichnung nicht wohl gemeint, daß die Familienzusammenhänge in Vergessenheit gekommen wären. Der Stammbaum wächst vielmehr in seiner Bedeutung. Seit dem dritten Jahrhundert n. Ch. G. dringen fremde Namen ein. Auch gewöhnte man sich mehr und mehr daran mit nur einem Namen bezeichnet zu werden. In einzelnen Familien, besonders solchen, die ihren Ursprung von römischen Senatoren ableiteten, behielt man die Namenhäufung bei. In den Jahrhunderten der sogenannten Völkerwanderungen treten allenthalben große Verschiebungen und Veränderungen in der Namenführung auf, welche auf griechische, keltische und besonders germanische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Germanen begnügten sich lange mit den Eigennamen der Person ohne jede weitere Kennzeichnung des Geschlechts, oder der väterlichen Abstammung. In Folge ihres Einflusses auf die (176 ≡)
gesellschaftlichen Verhältnisse löst sich das alte römische Namensystem mehr und mehr auf, und man muß bei der weitern Entwicklung die verschiedenen Gebiete unterscheiden. Man wird zwischen Frankreich und Italien wesentliche Unterschiede zu machen haben und selbst in Nord- und Südfrankreich verschiedene Gebräuche in der Namenführung wahrnehmen. In Italien erscheint es dann als eine Art von Renaissance, wenn dann doch früher als in anderen Ländern der Familienname wieder zu Ehren kommt. In Venedig wird die patrizische Verfassung diesen Erfolg gehabt haben. Im übrigen Italien herrscht dann wie später in Frankreich und Deutschland die Bezeichnung der Person nach dem Orte von dem sie herstammt vor. Es kommt auch schon vor, daß die Herkunftsbezeichnung auch bei Wechsel der Ansässigkeit beibehalten wird, also der Fall, in dem diese am natürlichsten sich in den Familiennamen verwandeln mag.[104] Auch finden sich Verwandtschaftsbezeichnugen, aber doch nur selten patronymische Bildungen.[105] Beinamen die mit der Herkunft nichts zu thun haben, sind im 10. Jahrhundert in Italien nur selten.[106] In Frankreich will man wahrgenommen haben, daß schon im siebenten Jahrhundert drei Viertel der Personennamen unter dem Einfluß germanischer Namenbildung gestanden hätten.[107] Auch finden sich da nicht selten Doppelnamen, die durch qui et vocatur, durch sive oder cognomento verbunden werden. Diese seit dem 6. Jahrhundert aufkommenden Erscheinungen mehren sich im südlichen (177 ≡)
und südwestlichen Frankreich seit dem Ende des 9. Jahrhunderts und werden allgemeiner im 11.[108] Daneben kommt auch der Vatername häufiger als sonst zu dieser Zeit in Italien in Anwendung: 781 Paulus fil. Pandionis de Reate, 969 Benedicti filii Johannis, 1017 Geraldus filius Carlucio, auch ohne filius: 990 Ingelbertus Pitacis, 1020 Guillelmus Hibrini.[109] Seit dem Ende des 10 Jh. werden in Frankreich und Deutschland die Personen in den Urkunden oft durch Anmerkung ihrer Heimat, meist mit de, selten im Adjectiv, näher bestimmt; z. B. Herbertus Britto, Thomas de Marla.[110] Dieser Zusatz wird zuerst in den oberen Kreisen allgemeiner, wo er nicht nur den Wohnsitz, sondern auch die Herrschaft bezeichnet und mit dieser auf die Nachfolger übergeht. Der Umstand freilich, daß wir bei Grafen schon in fränkischer Zeit oft den Namen ihrer Stadt (in Frankreich) oder ihres Gaues (in Deutschland) finden, darf uns nicht zu genealogischen Schlüssen verführen, da das Grafenamt damals noch nicht erblich war. In Ottonischer und Salischer Zeit aber wurden die Lehen immer häufiger erblich ertheilt und als solche auch die Grafenämter behandelt.[111] Für den Anfang des 11 Jh. können wir die Erblichkeit der Grafschaften schon als Regel annehmen. In dieser Zeit begannen Grafen und Edle ihre Herrensitze im Thale zu verlassen, auf den Höhen feste Burgen zu bauen und sich nach diesen zu benennen. So finden wir im Jahre 1024: testimoni Herimanni de Werla, Ekkika de Aslan - - comitum[112], 1028: Comitibus Christiano de hudenkirchen: hermanno de noruenich[113] 1037: Poppo comes de Henneberg[114] (178 ≡)
u. s. w. Auch bei den niederen Ständen festigen sich mehr und mehr die persönlichen Heimatsbezeichnungen zu erblichen Familiennamen. Hier ist zu beachten, daß es Familien gleichen Namens giebt, die keine Verwandtschaft mit einander haben, da oft mehrere Dienstmannen an einem Orte saßen, und daß aus demselben Grunde oft Herren und Diener den gleichen Namen führen. Doch begnügen sich in den Urkunden noch im 11. Jh. sehr viele mit Titel und Taufnamen, auch Grafen und Edle. Erst seit der Mitte des 12. Jh. sind Familiennamen bei diesen die Regel, wobei aber jüngere Linien mit neuen Wohnsitzen noch oft neue Namen erwerben. Beim niederen Adel werden zuweilen noch im 13. Jh. die Familiennamen ausgelassen. Noch langsamer verschafft sich eine andere Gattung von Familiennamen Eingang: Seit dem Anfang des 11. Jh. vermehren sich in Frankreich die Beispiele von charakterisierenden Beinamen (die aber nicht mit den oben erwähnten doppelten Eigennamen zu verwechseln sind), z. B. Thedbaldus Rufus, Joscelinus Parvus, Guido Rubeus, Odo cum barba,, auch nach besonderen Ereignissen oder Redewendungen, z. B. Hugo Manduca Britonem, Pendens lupum, Jerusalem oder nach dem Amte: advocatus u. s. w.[115] Diese Beinamen pflegte man zwischen den Zeilen über die Eigennamen zu schreiben (daher surnoms), ein Brauch, der später auch in den Rheinlanden Eingang fand.[116] Seit dem Ende des 11. Jh. werden diese Beinamen zu erblichen Familiennamen. In Deutschland finden wir sie vereinzelt seit dem Anfang des 12. Jh., häufiger seit der Mitte des 13.: 1133 Heinricus Fuhszagil in bayrischer Urk.[117]; 1141 Herimannus niger. Herimannus (179 ≡)
albus. – Albero karraman. Herimannus cum barba in Köln[118]; 1157 Arnoldus Rufus. Siboldus Albus in Erfurt[119]; 1159 Wartwin Emmersacker und Udalricus Engnach in Augsburg[120]; 1159 Heinricus Houe in brandenburgischer Urk. Für Magdeburg[121]; 1170 Gerlachus Gramann in Fuldaer Urk.[122]; 1210 Siboldus Humularius, - Hartliebus Gensevuz, Wernherns Cellarius, Guntherus Spisarius in Erfurt[123] u. s. w. Auch hier werden sie rasch erblich. 1267 heißt es in Erfurter Urkunde: Hugo Longus filius Gothscalci Longi [124]. Wir können diese Bezeichnungen wohl fast gleich nach ihrem Auftreten in Deutschland als Familiennamen auffassen. Im Osten treffen wir sie später als im Westen, östlich des 30. Längengrades v. F. nicht vor der Mitte, in Berlin erst gegen Ende des 13. Jh.[125] In Wien war zu Anfang des 14. Jahrhunderts in der obern Bürgerschaft der Gebrauch des Familiennamens bereits allgemein; aber der ursprüngliche Character desselben als Beinamen zeigt sich noch in dem vorgesetzten Artikel „der“, das lateinische dictus, erst um 1380 wird dies „der“ vereinzelt weggelassen und man erhält alsdann die bis heute übliche Form z. B. „Niklas Steiner“.[126] Diese Entwicklung führt aber überall zum Verschwinden des Wörtchens (180 ≡)
de mit der Ortsbezeichnung bei Personennamen insbesondere von Bürgern oder Bauern seit dem 15. Jahrhundert, und es läßt sich aus dem Fehlen oder Vorhandensein desselben durchaus nicht auf irgend ein Standesverhältnis schließen. Patrizische Geschlechter in den Städten und ritterbürtige Familien kommen ohne Ortsbezeichnung und folglich auch ohne das Wort de vor.[127] Das sechzehnte Jahrhundert bringt die Entwicklung unserer Familiennamen im allgemeinen zum Abschluß.[128] Hier soll nur noch auf einige Schwierigkeiten hingewiesen werden, die sich dem Genealogen bei der Aufstellung seiner Stammtafeln besonders häufig ergeben.
IV. Hülfswissenschaften.Unter den historischen Hülfswissenschaften. die der Genealog kennen muß, nimmt die wichtigste Stelle die Urkundenlehre ein. Was daraus im Besonderen für genealogische Zwecke wichtig ist, soll im Folgenden kurz zusammengestellt werden. Personen können in Urkunden auf verschiedene Arten auftreten: 1. als Aussteller, 2. als Empfänger, 3. als Fürbitter und sonst in der narratio, 4. als Zeugen, 5. als Kanzleibeamte im Schlußprotokoll. Die Echtheit der Urkunde vorausgesetzt, scheint an der Existenz von Aussteller und Empfänger zu der angegebenen Zeit nicht gezweifelt werden zu können, und doch kommen echte Urkunden vor, die als Datum einen Zeitpunkt geben, an dem nach anderen sicheren Quellen die eine der beiden Hauptpersonen bereits tot war. Sie kann während der Abfassung der das Datum der Ausfertigung tragenden Urkunde gestorben sein oder der Hersteller der Urkunde rechnete nach einem anderen Jahresanfang als die Quelle, die uns das Todesdatum überliefert. Hier ist es nützlich zu wissen, daß die meisten Privaturkunden bis ins 13. Jahrhundert von den Empfängern, fast immer geistlichen Stiften, herrühren und daß jeder Orden seine bestimmte Zeitrechnung hatte.[133] Damit muß der Genealog rechnen bei Feststellung seiner Daten. Als Fürbitter (intervenientes) erscheinen häufig Verwandte des Empfängers oder des Ausstellers, und wegen dieser Beziehungen (183 ≡)
sind sie für die Genealogie von besonderer Wichtigkeit. Doch beweist ihr Vorkommen auch nicht immer, daß sie zu der im Schlußprotokoll angegebenen Zeit noch am Leben waren. Gemäß den mannigfachen Rechtsgeschäften, die den Inhalt einer Urkunde bilden können, erhalten wir in ihrem erzählenden Hauptteil oft die mannigfachsten genealogischen Daten. So wird bei frommen Stiftungen nicht selten erwähnt, daß sie zum Gedächtnis eines namentlich angeführten Verwandten errichtet werden. Ferner erfahren wir von Stiftungen der Vorfahren und gewinnen dadurch leicht einen Anhalt, um die Genealogie eines Geschlechtes noch über das erste Vorkommen der Familiennamen hinaufzuführen. Bei den Zeugen in den Urkunden gilt für ihre Lebensdaten das, was bei Aussteller, Empfänger und Fürbittern bemerkt ist, in noch höherem Maße, da hier die Ungleichheit der chronologischen Behandlung am stärksten ist. Das Datum kann sich auf die Beurkundung beziehen und die Zeugenreihe auf die Handlung oder umgekehrt, auch sind manchmal Zeugen der Handlung mit solchen der Beurkundung vermengt.[134] Wichtige genealogische Anhaltspunkte bietet die Rangordnung der Zeugen. Sie wechselte freilich selbst innerhalb der einzelnen Kanzleien nach verschiedenen, sich oft kreuzenden Gesichtspunkten. Doch haben die Untersuchungen Fickers[135] wenigstens für das 12. bis 14. Jahrhundert feste Regeln ergeben, die man wohl in folgendem Schema darstellen darf:
Diese Regeln sind manchmal das einzige Mittel, um die Stellung eines Geschlechtes zu bestimmen oder den Träger eines (185 ≡)
von mehreren Familien geführten Namens der seinigen einzureihen. In einer Urkunde v. J. 1239 werden als Zeugen aufgeführt zwei Grafen und drei nobiles, es folgt ohne Standesbezeichnung: Alhardo de Preisingen, Sifrido de Vrowenberch, Ortolfo de Waldeck, Hadmaro de Wesen, et aliis quam pluribus.[136] Die Stellung der Zeugen läßt uns hier mit Sicherheit annehmen, daß wir unter Ortolf von Waldeck nicht ein Mitglied der bekannten Grafenfamilie, sondern wahrscheinlich einen ihrer Dienstmannen zu verstehen haben. Unregelmäßigkeiten und Nachträge sind natürlich in den Zeugenreihen nicht selten, doch sind sie oft als solche zu erkennen.[137] Die geringste Ausbeute gewährt dem Genealogen das bei Herstellung der Urkunde beteiligte Beamtenpersonal. Die selten erwähnten Schreiber kommen kaum in Betracht; dagegen dürfen die Notare und Kanzler der Fürsten, vor Allem die königlichen und kaiserlichen Kanzler, die meist den ersten Familien des Reiches angehörten, bei genealogischen Untersuchungen nicht übersehen werden.[138] Die Siegel der Urkunden darf der Genealog nicht außer Acht lassen. Sie finden sich im 10. Jahrhundert vereinzelt, seit dem 11. allgemeiner an Urkunden geistlicher Fürsten, seit dem 12. auch bei den weltlichen Großen.[139] Die Siegelfähigkeit war seit dem 13. Jahrhundert allgemein, sodaß ans dem Gebrauch oder dem Mangel eines Siegels kein Schluß auf den Stand des Ausstellers erlaubt ist. Auch die Unterschiede in Stoff und Farbe der Siegel sind für unsere Zwecke unerheblich. Wichtiger ist die Beobachtung, daß Porträtsiegel mit ganzer Figur zu Fuß oder zu Pferd mit wenigen Ausnahmen nur beim hohen Adel vorkommen.[140] Die Inschriften der Siegel sind sehr mannigfaltig, bringen aber meistens den Namen und Titel des Inhabers. (186 ≡)
Seit dem letzten Drittel des 12. Jahrhunderts finden wir Wappen auf Siegeln des hohen Adels, und damit gewinnt die Genealogie eine neue wichtige Hülfswissenschaft in der Heraldik. Wappensiegel sind seit dem 13. Jahrhundert allgemein, seit seinem letzten Drittel auch bei dem niederen Adel, etwas später folgen die Altbürger in den Städten. Von den übrigen Quellen der Heraldik sind Denkmäler, Gemälde, Wappenrollen und Geschichtschreiber genealogisch wichtig. Die Wappen gehen von den Vätern auf die Söhne über, Jahrhunderte hindurch von der Mode nur in Einzelheiten verändert. So läßt sich der gemeinsame Ursprung von Familien vermuten, die dasselbe oder ein ähnliches Wappen führen, auch wenn sie sich nach verschiedenen Wohnsitzen nennen. Andererseits kommt es auch vor, daß die verschiedenen Zweige einer Familie, die den gemeinsamen Namen behalten, sich durch geänderte Wappen von einander unterscheiden. Z. B. ist das Wappen des hochfreien Geschlechtes von Lobdeburg ein weißer Schrägbalken in Rot; die jüngeren Linien in Arnshaugk und Elsterberg führen dagegen einen roten Schrägbalken in Weiß, die in Burgau einen roten geflügelten Fisch in Weiß. Wenn wir nun ein Siegel finden mit dem geflügelten Fisch im Wappen und der Umschrift S. Hartmanni seniores de Lobdeburg,[141] dann giebt uns erst das Wappen die Sicherheit, mit welchem der zahlreichen Träger dieses Namens wir es hier zu thun haben. In Frankreich hatte man seit dem 13. Jahrhundert mehrere Systeme zur Kenntlichmachung der verschiedenen Linien durch Beizeichen im Wappen, besonders durch Turnierkragen und Schrägbalken. Bekannt ist das Bastardzeichen, ein roter linker Schrägbalken, der aber nicht durchweg diese Bedeutung hat. Zu allgemein gültigen Regeln ist man auch in der Blütezeit der Heraldik nicht gelangt. In Spanien ließ man die Wappen selbst unberührt und unterschied nur durch abweichende Schildeinfassungen. Eine nur in Deutschland übliche Sitte war die Anwendung verschiedener Helmzierden für die einzelnen Linien eines Geschlechtes.[142] (187 ≡)
Um das Alter von Denkmälern jeder Art bestimmen zu können, ist es dem Genealogen zu raten, sich mit den einschlägigen Teilen der Kunst- und Culturgeschichte, besonders auch mit der Costümkunde vertraut zu machen. Auf Grabsteinen und Gemälden fehlt oft jede Zeitangabe, oder sie ist nicht mehr zu entziffern. Glücklich ist dann der, den fleißiges Studium alter Denkmäler in Museen und Kirchen in Stand setzt, aus dem Werke selbst das Datum herauszulesen, das dem Laien verborgen bleibt.[143] Aber auch die schriftlichen Zeitangaben in den mittelalterlichen Quellen sind nicht Jedem deutbar. Ohne Kenntnis der Chronologie kann von allen historischen Arbeitern nächst dem Diplomatiker der Genealog am wenigsten bestehen. Die meisten neueren Werke über Urkundenlehre bringen einen Abschnitt über die Zeitrechnung, auch giebt es besondere Handbücher dafür.[144] Hier möge erwähnt werden, daß in dem Falle, wo ein römisches Datum mit einem kirchlichen in Widerspruch steht, dem kirchlichen die größere Glaubwürdigkeit zukommt, da man z. B. wol leicht VI. kal. Jun. verschreiben kann in XI. kal. Jun., aber Festum corporis Christi oder Gotsleichnamstag schwerlich mit andern Festen mechanisch verwechseln wird. Daß der Genealog die natürlichen Bedingungen des menschlichen Daseins mitaufnehmen muß in seine chronologischen Berechnungen, versteht sich von selbst.[145] (188 ≡)
Alphabetisches Verzeichnisvon Wörtern, die Abstammung, Verwandtschaft u. dgl. bestimmen.[146]
(189 ≡)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Das Grimmsche Wörterbuch setzt ohne weiteres Ahnentafel dem Geschlechtsregister und Stammbaum gleich. Ein Beleg ist nicht gegeben; während unter Geschlechtsregister und Geschlechtstafel ganz allgemein „genealogia“ verstanden wird. „Geschlechtstafel“ wird von Fischart im Sinne der Ahnentafel und von Kleist im Sinne der Stammtafel gebraucht. Im Wörterbuch von Heyne wird Stammtafel als eine Tafel bezeichnet, auf der ein Geschlecht nach Abstammung und Ausbreitung verzeichnet ist, eine Definition, die streng genommen in der That nur auf die Descendenz anwendbar ist; aber das Wort Ahnentafel ist daneben ganz unbekannt. Das Wort Stamm bezeichnet aber nach Heyne etwas feststehendes, woraus anderes sich entwickelnd abzweigt, hervorgeht, und woran hinzutretendes sich anschließt, was dafür die feste Grundlage, Stütze, Kern, Mittelpunkt bildet. In diesem Sinne darf man es also durchaus für sprachlich gerechtfertigt halten, von Stammtafel nur im Sinne der Descendenz zu sprechen, obwol der bestehende Sprachgebrauch überall unsicher und willkürlich ist und auf einen großen Mangel an Sachkenntnis schließen läßt. Im Französischen macht table genéalogique den Unterschied der Descendenz und Ascendenz ebenfalls nicht deutlich erkennbar. Doch unterscheidet man beim „Arbre généalogique“ sehr bestimmt ascendant und descendant. Sehr merkwürdig ist, daß die Geste des Normands on Roman de Rou eine Chronique ascendant um 1160–1174 enthalten, worin die Herzöge bis auf Rollo hinaufgeführt werden. Vgl. Gaston Paris, I,itterature francaise au moyen age No. 93 p. 134, Romania IX. 598.
- ↑ Vgl. Delbrück, die Indogermanischen Verwandtschaftsnamen, Abhdlg. d. sächs. G. XI. 580. Für folgende Notiz bin ich auch Delbrück noch zu Danke verpflichtet, indem er mir schreibt: in den Hausregeln könne kein Zweifel sein, daß ursprünglich nur Vater, Großvater und Urgroßvater beim Opfer ermahnt wurden, die weiblichen Aszendenten aber erst im Laufe der Zeit hinzutraten. Uebrigens ist auf Coland, Altindischer Ahnencult. Leiden 1893, zu verweisen. Bei einer gewissen Gelegenheit, wo von den Opfern aus der Reihe der Rishi's die Rede ist, macht Delbrück übrigens auf das Erfordernis von Nachweis von 10 Ahnen aufmerksam. Ob hiebei nicht doch die mütterlichen gezählt wurden?
- ↑ Sprachvergleichung und Urgeschichte von D. Schrader, 2. Auflage, S. 542 ff.
- ↑ Ebd. S. 546; daher spricht sich Schrader in seinem trefflichen Werke gegen die von Bachofen verbreitete Meinung der Promiscuität der Arier sehr bestimmt aus und auch gegen die Ausführungen Leists, Graecoitalische Rechtsgeschichte, welcher den „aus dem Obsequium gegen die Parentes erzeugten cognaitischen Familienbegriff für uralt arisch erklärt und die aus diesem gegründete Vorstellung eines engeren Verwandtenkreises für das älteste des alten hält, was die Griechen und Italier von ihren Vorfahren erhalten hätten". Man dürfte vielleicht dieser Ansicht gegenüber auch den Zweifel aussprechen, ob überhaupt einer agnatischen und cognatischen Entwicklung des Familienbegriffs das menschliche Gedächtnis Stand zu halten vermöchte, solange es nicht durch Schriftkunde unterstützt wird. Die Ahnentafel ist wahrscheinlich ohne Schriftthum etwas gar nicht denkbares. Studien hierüber bei mannigfachen Völkern wären erwünscht.
- ↑ Daß freilich es selbst in gelehrten Kreisen an einem Verständnis der fundamentalen Begriffe zuweilen gebricht, ist noch jüngst in dem lippischen Erbfolgestreit hervorgetreten, wo es selbst Herrn Professor Kahl wirklich passirt ist, sogar „Genealogen“ aufzutreiben, denen die Unterschiede von Stammtafeln und Ahnentafeln völlig unklar waren. Es sei dies nur gesagt, um auch die Jurisprudenz aufmerksam zu machen, daß es doch nicht angeht, eine noch so vielfach in Rechtsverhältnisse eingreifende Wissenschaft vollständig dem Dilettantismus anheim fallen zu lassen.
- ↑ Auch im bildlichen Sinne ist die Stammtafel schon seit ältesten Zeiten in Anwendung gebracht worden, Beispiele dafür s. weiter unten im zweiten Kapitel etwa die Stammbäume der Dominikaner u. a,, doch dürfte man eigentlich wünschen, daß die Dinge etwas sorgfältiger auseinandergehalten würden. Man bedient sich des Ausdrucks Stammbaum in den verschiedenen Wissenschaften gewiß nur im Sinne eines Bildes, aber die Schlüsse, die zuweilen aus dieser tropischen Redewendung gezogen werden, sind bedenklich, weil Begriffe zwar nach Analogie eines Stammbaums fortschreiten können, aber doch nie einen wirklichen Vater haben. Ebenso verwirrend ist es, wenn man etwa von einem Stammbaum der Menschheit oder von einem Stammbaum der Thiere spricht, weil nur der Mensch, oder das Thier in seiner Besonderheit, nicht aber der abstracte Mensch und der Begriff vom Thier Kinder erzeugt. Die Genealogie muß sich mithin gegen den Gebrauch des Wortes Stammbaum in jeglichem tropischen Sinne verwahren und kann ebensowenig die „Sprachenstammbäume“, wie die „zoologischen Stammbäume“ zu Darstellungen des wirklichen genealogischen Stoffes rechnen, weil sie sich nur mit den wirklich nachweisbaren Zeugungen bestimmter Individuen beschäftigt.
- ↑ Ueber die Geschichte des Wortes arbor wird wol erst der thesaurus volle Aufklärung bringen; ich habe nicht unterlassen anzufragen, wie weit das Material vorliegt, aber nichts erfahren. Du Cange (Le Favre), 1883, kennt arbor alfinitatis nicht; und arboretum nur als locus arboribus consitus und als tributi species. Bei Isidor:Orig. wird die ausdrückliche Bezeichnung, arbor eigentlich auch noch vermieden, darüber weiter unten. Stintzing, Gesch. d. pop. Lit. d. röm. Rechts S. 152, sagt daher vorsichtig, Isidor habe den Namen arbor „autorisirt“.
- ↑ Stintzing ebd. S. 151. Du Cange, Stemma pro schema seu σχῄμα. Dann erst im XI. und XII: Jhdt. Belegt als Generis species; aber metonymisch als Genealogie, Verwandtenreihe, Stammbaum schon bei Seneca, Suenton u. A. In den ältesten Verwandtschaftsverzeichnissen ist jedenfalls, wie gleich zu zeigen ist, das Stemmanichts als ein Schema
- ↑ Eine alte deutsche Bearbeitung des Arbor (Stintzing a. a. O., sechste Classe Nr. Hh und Si S. t79): Uund ist wol ein umbkerter boume, des este under sich gont; als auch der Mensch in der geschrift ein umbkerter boume genennt wurd und dem geleichet.
- ↑ Fig. I, unten, außerordentlich häufig, bei Huschke, Jurisprud. antejust. 513-517 und Hänel, Lex Romana Visig. auf Tafel und S. 456 ff. mit Bezeichnung der zahlreichen Handschriften im Vatican, in Paris u. s. w. dazu Stintzing a. a. O.: paterfamilias, qui in domo dominium habet.Dabei fehlt aber die Beachtung der Aufschrift: Lege hereditates quemadmodum redeant. Auf den wichtigsten Umstand, daß die Mutter hier noch nicht erbt, und auf die Bedeutung des S. C. Tertullianum hat mich mein hochverehrter College Kniep aufmerksam gemacht, dessen freundlichen Belehrungen ich hierbei vieles verdanke.
- ↑ Fig. II, unten, Huschke a. a. O., vgl. Isidor Hisp. Orig. IX. c. 6 etwas abweichend. Der Vermerk „Usque ad hunc laterculum immunes personae sunt“ findet sich bei der dritten Stufe und bezieht sich keinesfalls meines Erachtens auf die vierte. Eine Schwierigkeit ist es, daß Trajan vgl. Plinius Paneg. 39 die Steuerfreiheit nur auf den zweiten Grad ausdehnte. Entweder ist also der Vermerk von Schreibern, die denselben nicht mehr verstanden haben, fälschlich zur dritten Stufe gesetzt worden, oder es liegt ein besonderer Fall vor. Dagegen bezieht Conrat, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts Bd. I. S. 84 die Immunität auf das vinculum matrimonii, siehe den Nachtrag zu diesem Capitel unten.
- ↑ Stintzing a. a. O. Hänel hat im ganzen 6 Formen abgebildet. Die Kreisform findet sich auch bei Isidor a. a. O., septem circulis inclusa sunt. Cod. Pad. 4410 und 4412, anderweitige Darstellungen habe ich in mancherlei deutschen Codd. in München gesehen, z. B. Cod. germ. 660, Cod. germ. 757 f. 18 u. 19 und Cod. germ. 632 fol. 122 , beide sec. XV. Das von Joh. Andree erwähnte Fähnlein hat am deutlichsten Cod. Germ. 601. fol. 81: Albrechts von Eyb in Nürnberg verfaßte Uebersetzung des Eherechts, so auch in Cod. germ. 1115 fol. 13, vgl. auch den sogenannten Arbor actionum des Joh. Bassianus, nichts weniger als ein Baum; Brinz Arbor actionum p.11 sq. über den Arbor affinitatis Joh. Andree, vgl. unten Anm.
- ↑ Fig. 3, unten, nach Hänel a. a. O. Cod. Vat. u. Par. sec. IX. u.X. Isidor, Orig. lib.X. De affinitatibus et gradibus cap. V. Hier kommt schon der Ausdruck stirps vor. Dann: Stemmata dicuntur „ramusculi“ sc., dann citirt Stintzing, Isidor Decret c. l. C. 35 qu. 5 , jedoch sei die Stelle interpolirt nach Wasserschleben. Hier kommt es lediglich darauf an, daß diese Worte schon frühzeitig gebraucht sind und also aus der bezeichneten Figur entstanden sind.
- ↑ Figur 4 u. 5. Schöne Abbildungen bei Böhmer Corpus juris can. tom. I. p. 1099, Decreti p. II. qu. 5. C. I.: De gradibus vero consanguinitatis. Sex gradibus hoc modo dirimitur filius et filia, quod est frater et soror, sit „ipse“ truncus: illis seorsum seiunctis ex radice illius trunci egrediuntur isti ramusculi, nepos etc. – „iuxtra Isidorum, qui mox post tempora Gregorii floruit“. Die Abbildungen in Hdschftn. des XV. Jahrhunderts sehr zahlreich. Auch Stintzing a. a, O. gibt zu, daß in der Figur die geometrische Grundform des Baumes gewonnen war: „Man braucht nur die geraden Linien mit den freieren Formen der Vegetation zu vertauschen“, um dem Bilde arbor gerecht zu werden. Wenn aber Stintzing die Entstehung des vollständigen Baumes erst der Hand der kunstsinnigen deutschen Drucker zuschreibt, so widersprechen doch dem mancherlei handschriftliche Zeichnungen, wo der Baum doch auch schon ganz entwickelt ist - auf die Schönheit kommt es dabei nicht an: Cod. germ. 1115 f. 13 in München hat sec. XV einen regelrecht zweiseitig verästeten Baum. Auch sind doch die Aeste in Fig. 4 nicht erst vom Drucker erfunden. Als Blätter freilich kann man die runden Kreise, auf denen die Namen verzeichnet sind, nur im ornamentalen Sinne gelten lassen.
- ↑ Savigny, Gesch. d. röm. Rechts III. 167 und Ersch und Gruber, Bd. III, s. v. Andreae. Im Zedlerschen Lexikon wird versichert, daß der pater juris canonici et omnium juris can. interpretum facile princeps durch zwanzig Jahre unter einer Bärenhaut geschlafen habe.
- ↑ Stintzing a. a. O. Formatur sic arbor. Nunc formemus arborem.
- ↑ Mit dein Fähnlein hat es nun aber ein besonderes Bewandtnis. Eine sehr schöne Abbildung dessen, was Andree wahrscheinlich unter dem vexillum verstanden haben wird, habe ich in einem Münchencr Codex germ. 601. in Albrecht von Eybs Eherechtsbuch gesehen, fol. 81. Hier ist überschrieben: arbor consanguinitatis vulgarisata cum autenticis successionis ab intestato und am unteren Ende die Aufschrift: Arbor Johannis Andree 1472. Es ist ein deutlicher Baumstamm mit neun Tafeln, in deren Mitte der Ehecandidat gedacht ist, vier Verwandtschaftsgrade nach oben, und vier Verwandtschaftsgrade nach unten, hier also Sohn und Tochter, Enkel und Niftel, Enkels und Niftels Sohn oder Tochter, Enkels und Niftels Kinds Kind; dort Vater und Mutter, Ahnherr und Ahnfran, Großahnherr und Großahnfrau, Vorahnherr und Urahnfrau. Von den vier oberen Graden gehen nach links abgezweigt die ramusculi mit den absteigenden Linien der vier Voreltern. Da die rechtsseitigen ramusculi fehlen, so könnte man sich leicht das Bild als eine fliegende Fahne vorstellen, es ist aber vom Zeichner der Handschrift doch offenbar nur an den Arbor gedacht, wie die ornamente vermuten lassen.
- ↑ Vgl. die Tabula consanguinitatis Friderici I. regis et Adelae reginae im Cod. Ep. Wibaldi, Jaffe, Monum. Corbeiensia Bibl. I. 547. no. 408.
- ↑ Beschreibung und Abbildung in Mon. Germ., Script. VI. praef. und Archiv f. ä. G. VII. 471: „Am Schlusse der Geschichte der Karolinger Bl. 1521 findet sich eine sorgfältig geschriebene und gezeichnete Stammtafel derselben und Bl. 1711 nach Heinrichs I. Tode eine ähnliche des sächsischen Hauses; besonders sind die Eltern des hlg. Arnulf für das Ende des elften Jahrhunderts auffallend gut gezeichnet; sie halten eine Pergamentrolle, aus welcher sich der Stammbaum entwickelt." Auch auf dem sächsischen Stammbaum ist es eine Figur, die den Stammbaum in der linken Hand hält, Sic ist genannt: Jvitolfus dux Saxonum und hält in der rechten Hand einen Cirkel, auf welchem geschrieben ist: Brun dux a Danis occisus. Die Tafeln sind im übrigen in absteigenden Linien gedacht und die Reproductionen sind nicht sehr genau. Schon das Facsimile der Mon. Germ. läßt manches zu wünschen, dann sind von da weitere, immer weniger treue Nachbildungen in populären Geschichtsbüchern gemacht worden. Alles, was sonst das Mittelalter an Genealogieen hervorgebracht, findet man selbstverständlich unter „Genealogie" bei Wattenbach, Lorenz und Potthast zusammengestellt und es wäre eine dankbare Arbeit, die formale Behandlung dieser Dinge einmal besonders zu besprechen. Unseren heutigen genealogischen Begriffen entsprechend, dürften wol die flandrischen Genealogieen am meisten entwickelt erscheinen.
- ↑ Die Reproduktion ist in der Straßburger Ausgabe planche 25 B. nach den geretteten Theilen des hortus deliciar. wolgelungen und ich ergreife die Gelegenheit, um dem Herrn Dr. Weber hier in Jena für diese und manche andere Mittheilung bestens zu danken, Beschreibung des Bildes auch bei Engelhard, Herrad von Landsberg 1818.
- ↑ Janitschek, Gesch. der deutschen Malerei, Berl. 1890, S. 159 ff. Der Ausdruck Stammbaum Christi ist für dieses merkwürdige Gemälde jedenfalls nicht wörtlich zu nehmen. Die Hauptbilder in der Mitte, David und andere Könige, entwickeln sich eigentlich nicht aus dem Stamme, der überdies nicht zu Christus hinaufsteigt, sondern von ihm ausgeht.
- ↑ Gruner, Ludw. Die Basreliefs an der Vorderseite des Doms zu Orvieto, Marmorbildwerk der Schule der Pisaner mit erklärendem Text von Emil Braun, Leipzig 1858, Tafel 19 ff. Der bekannte Erbachsche Stammbaum Jesse liegt mir leider nicht in Abbildung vor.
- ↑ Otte, Hdbuch. D. kirchl. Kunstarchäologie I. 516 sagt: „Eine seit dem dreizehnten Jahrhundert beliebt werdende, namentlich in Glasmalereien vorkommende Darstellung ist der aus der Wurzel Jesse, Jesaias 11, 10 erwachsende Stammbaum Christi. Unten liegt Jsai, der Vater Davids, in Patriarchentracht und auf seiner Brust wurzelt ein Weinstock, der aus seinen Reben, durch Ranken verbunden, den biblischen Geschlechtsregistern folgend, die Bilder der Vorfahren Christi trägt und in der Darstellung des thronenden Salvators gipfelt. Die ausführlichste mit Adam und Eva beginnende Reihenfolge ist in der Deckenmalerei von St. Michael in Hildesheim enthalten. Eines der vorzüglichsten Beispiele dieser Art ist der berühmte Schnitzaltar des Veit Stoß in der Marienkirche zu Krakau. - Analog sind die im Spätmittelalter vorkommenden Stammbäume der Mönchsorden, z. B. der Stammbaum der Dominikaner mit den vorzüglichsten Heiligen dieses Ordens z. B. am Lettner der Dominikanerkirche zu Bern, vereint mit dem Christi v. 1472, allein in Holzschnitt v. 1473.
- ↑ Ich ergreife hier die Gelegenheit, um meinem hochverehrten Freunde Herrn Custos Wöber an der Hofbibliothek in Wien Dank zu sagen für seine vielen Mittheilungen aus dem reichen Schatze seiner geneal. Kenntnisse. Er ist der Vertreter einer Richtung, die sowol die heraldische wie die genealogische Wissenschaft vielfach auf eine Symbolik zurückzuführen strebt, deren Vorhandensein überhaupt zu läugnen oder gar zu belächeln, nur als eine Bequemlichkeit der heutigen Forschung aufgefaßt werden könnte. Aber dieses Gebiet ist schwierig und wird seit Creuzers Zeiten immer wiederum aufleben und untergehen, Herr Wöber hat einen sehr beachtenswerthen Beitrag zur Symbolik in seiner Schrift über die Heraldik des Uradels geliefert.
- ↑ Dynter, vgl. meine Gesch. Quellen II. 29 ff., ist schon von Neuwirth in seinen früheren Arbeiten über die Burg Karlstein, Prag l896, benutzt worden. Die Stelle läßt aber nichts sicheres über die Art der Ausführung des Stammbaums erkennen. Jetzt hat aber Neuwirth, Prag 1897, „Die Wandgemälde auf der Burg Karlstein“, die Sache nach dem Wiener Codex genauer beschrieben und die Abbildungen selbst in trefflicher Reproduction mitgetheilt.
- ↑ Einen Anfang dazu findet man in mannigfaltigen Mittheilungen der Zeitschrift des deutschen Herold, wie 1895 S. 54, 55, S. 98 u. a. a. O. Einiges beabsichtigt Walther Gräbner zu veröffentlichen, der in Dresden und Berlin vieles Schöne verzeichnet hat.
- ↑ Aus den Schätzen der Wiener Hofbibliothek bin ich durch die Güte des Herrn Custos Wöber in der Lage, einiges hier zusammenzustellen:
- Das Bruchstück eines Stammbaums, Holzschnitt nach Art des Ambraser Stammbaums aus dem sechzehnten Jahrhundert.
- Stammbaum der Habsburger, zwei Meter hoch, eineinviertel Meter breit, auf Holzrahmen.
- Stammbaum der Habsburger, zehn große Perg.-Blätter, sec. XVI. Von Rudolf Graf zu Habsburg sc. bis auf Maximilian I., dessen Todesjahr noch angeführt ist.
- Pramer, Wolfgang-Wilhelm, Hofkriegsrath, Arbor monarchica repraesentans omnes universi orbis monarchas. 18 Blätter gr. Fol. Von Adam bis 1690, electus est Josephus I.
- Calin Dominik, Franz, Von diesem sind vier genealogische Arbeiten in Stammbaumformen vorhanden, eine in zwei Perg.-Blättern, eine in fünf, eine in achtzehn, und zwei in je einundzwanzig Blättern, Daß alle diese Dinge eben nur einen formalen Werth haben, braucht wol nicht erst bemerkt zu werden.
| I. | a | = | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. | c | d | e | = | f | g | = | h | k | = | l | = | m | n | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. |
|
| | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und | so | fort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da hierbei vorausgesetzt ist, daß die Heirat der Tochter g mit h in dem Familienstammbaum von a = b nicht weiter zu berücksichtigen ist, so bleibt Raum genug für die Mannslinien c und l, selbst wenn l zweimal verheiratet war. Eine dritte Heirat von l würde dann freilich schon wieder neue Schwierigkeiten machen, doch dürfte eine Fortsetzung doch durchaus nicht schädlich sein, wenn nur der Verbindungsstrich von Eltern zu Kindern deutlich genug wäre. Bei Heinrich VIII. würde die Sache freilich verwickelt, doch ginge es in folgender Weise:
| Heinrich VII. | = | Elisabeth von York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur.Heinr. VIII. | = | K.v.Arag. | = | A.Boleyn | = | J.Seymour | = | A. v. Cleve | = | Katharina | = | Katharin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | Howard | Parr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Tudor | Elisabeth | Edward VI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu bedenken wäre hierbei nur, daß die Tafeln eine starke Ausdehnung nach der Breite erhalten werden, wodurch z. B. im vorliegenden Falle die beiden Töchter Margarethe und Marie wahrscheinlich ausgeschlossen würden, aber hier wird sich noch eine weitere Frage erheben, ob es nicht überhaupt zweckmäßig wäre, Söhne und Töchter ein für allemale zu trennen, wie dies etwa Behr in seinen schönen Tafeln gethan hat. Es wäre dann nur dafür zu sorgen, daß die Generationen in Sichtbarkeit blieben, was dadurch möglich wäre, daß die Töchter vorangehen und die Söhne folgen nach folgendem Schema:
| I. | a | = | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | = | d | e | = | f | g | = | h | i | = | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. | l | = | m | = | n | = | o | p | q | = | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ================================================================== | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. | und so fort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parentel | V. | ❍ | 4. Grad. | |
| | | ||||
| IV. | ❍ 3. Gr. | ❍ 5. Gr. | ||
| | | | | |||
| III. | ❍ 2. Gr. | ❍ 6. Gr. | ||
| | | | | |||
| II. | ❍ 1. Gr. | ❍ 7. Gr. | ||
| | | ||||
| I. | ❍ | |||
Nach dem katholischen Eherecht wurde übrigens wie schon oben bemerkt, die längere Linie für die Gültigkeit des Eheverbots berechnet. Ein sehr schönes historisches Beispiel für die Ungleichheiten der Verwandtschaftsberechnungen führt Heusler D. P. II. 592 an, indem er darauf hinweist, daß die Ehe des Herzogs Konrad von Kärnten mit der Tochter des Herzogs Hermann von Schwaben, Mathilde, nach einem Ausspruch des Bischofs Adalbero wegen des zweiten Grads der Verwandtschaft auszuschließen gewesen wäre, quia frater et soror in supputationem non admittuntur. Die Verwandtschaft stand aber genealogisch folgendermaßen:
| Heinrich I. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Otto I. | 1. | Gisberga. | Ludwig IV. v. Frankreich. | |||||||||||||||||
| | |
| |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| I. | Konrad d. Rothe. | Lintgardt | 2. | Mathilde | Konrad v. Burgund | I. | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| II. | Otto, Hg. v. Kärnten | 3. | Gisberga. | Hermann, Hg. v. Schwaben | II. | |||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| Konrad, Hg. v. Kärnten | Mathilde | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sehr geeignet dagegen: Hildebrandt, Prof. Ad. M., Wappenfibel, Frankfurt a. M. Eine kurze Zusammenstellung der hauptsächlichsten heraldischen und genealogischen Regeln. Im Auftrag des Vereins „Herold“, wozu Gritzner, M., Handbuch der heraldischen Terminologie in zwölf germanischen und romanischen) Zungen, enthaltend zugleich die Hauptgrundsätze der Wappenkunst. Nürnberg 1890. Noch vollständiger wird endlich die Wappenfibel durch das treffliche „Heraldische Handbuch“ von F. Warnecke ergänzt, 4. Auflage, Frankfurt a. M. 1887. Mit 313 Handzeichnungen von E. Döpler d. J. Zur Adelsgeschichte im besonderen bedient man sich des älteren Adels-Lexicons von Hellbach, 2 Bde. Ilmenau 1825-26 und des neueren von Kneschke. Und des „Stammbuchs des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland“, 4 Bde. Regensburg 1860-1866, wobei unentbehrlich: Gritzner, M. Standes-Erhebungen und Gnaden-Acte deutscher Landesfürsten während der letzten drei Jahrhunderte, Görlitz 1877.
Was endlich die Sphragistik betrifft, so gehören zur Einführung in diese Wissenschaft G. A. Seyler, Abriß der Sphragistik. Wien 1884. A. Chassant et P.J. Delbarre, Dictionnaire de sigillographie pratique. Paris 1860. H. Grotefend, Ueber Sphragistik. Breslau 1875. Dazu noch Sphragistische Mittheilungen aus dem Deutsch-Ordens-Central-Archive von Dr. Pöttikh Graf von Pettenegg. Frankfurt a. M. 1887. Weiteres unter Nr. IV, Hilfswissenschaften.
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: 78; das Kapitel beginnt jedoch schon S. 77.
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: 290; das Kapitel beginnt jedoch schon S. 289.
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: 313; das Kapitel beginnt jedoch schon S. 312.
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: 370; das Kapitel beginnt jedoch schon S. 369.
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: den
- ↑ Vgl. Artikel Gustav von Rümelin. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. (19.3.2012)
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: Satzpunkt
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: angenommenen
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: Aufzählungszeichen gemäß Inhaltsverzeichnis ergänzt.
- ↑ Druckfehler:ysychologischer
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: desseben
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: Medailten